Have any questions?
+44 1234 567 890
Pressemeldungen und Kontakt
Für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungen ist großenteils Judith Krieg zuständig. Wenden Sie sich mit Ihren Anfragen und Rezensionsexemplaren wegen deshalb bitte an:
m 0176 313 045 88
t 0721 4908 35 35
f 0721 4908 35 36
Wir sind auch auf Social Media aktiv:
– Edition Converso
– Edition Converso
Seit dem Frühjahr 2020 stellen wir hier Pressemeldungen zur Verfügung. Sollten Sie einen Text zu einem älteren Titel benötigen, dann kontaktieren Sie uns gern unter presse@edition-converso.com.
Belinda Cannone „Auf einem dünnen Seil“
Erzählungen
… der Stoff, in dem jeder ein Faden ist, und nicht ein Faden könnte ausreißen, ohne den gesamten Stoff zu beschädigen.
Diese zehn Erzählungen von „Ausgegrenzten“, „Unsichtbaren“, „Vergessenen“ dringen tief in die Abgründe unserer Zeit, bis hin zum nazibesetzten Frankreich, den Jugoslawienkriegen, der Zerstörung der Natur, der Toxizität heutiger Kommunikation, der Verantwortungslosigkeit gegenüber unseren Kindern. Was ihre Lektüre so beglückend macht, ist die Haltung der Erzählerin, die Aura, die sie um die Ungehörten und ihre oft grausamen Schicksale legt. Zauberhaft leicht, doch unerbittlich präzis, zuweilen gewürzt mit einer Prise Sarkasmus ist diese Sprache, mit der Belinda Cannone in jeder Geschichte – wie verschieden Orte, Milieus und Zeiten auch sind – den „Goldnugget“, den Kräftepol freilegt, der die Wendung bringt; oder wie der kleine Tom in „Die Mauersegler“ es definiert: den Riesen in uns entdecken lässt. Der magische Moment des Staunens ist das Verbindungselement, das Grenzen unterwandernd, uns unmissverständlich erkennen lässt: Es ist unsere Welt.
Belinda Cannone reißt uns, unsere Mitwisserschaft voraussetzend, mit in diesen pas de deux, nur so kann sich die ganze Poesie der Geschichte entfalten: Das Staunen, wie Emmanuel Carrère so treffend kommentiert, ist der Schlüssel zu Belinda Cannones Werk. In diesen Erzählungen lässt sie uns staunen über unsere Schwächen, unsere Mängel, unsere Fehler – über all das, was uns menschlich, bedauernswert und einzigartig macht.
In „Celéste“ lebt eine 20jährige mit ihrer Mutter in einem Tal unter vorwiegend weiblichen Aussteigern. Eines Tages im bitterkalten Winter geht sie fort, in den Wald, um dort zu leben. Damit bringt sie eine Lawine ins Rollen: Schuld, Scham, Verdächtigungen, Niedertracht, allfälliges Versagen legen sich wie ein Netz über die Gemeinschaft. Niemand kann sich mehr hinter dem Spiegel verstecken. Andere Kinder im Tal scharen sich zusammen, steigen hinauf zum Grenzpass, versuchen durch ein Loch im Zaun zu entkommen, durch das in der Gegenrichtung afrikanische Flüchtende eindringen. Die Erwachsenen: „… wir wollten nur mehr Freiheit, wir waren fröhlich, während unsere Kinder sehr wütend sind, (…) sie werfen uns alles vor, den Zustand der Welt, des Planeten, sie sagen Ihr habt alles kaputtgemacht. Im Gegenteil (…), wir wollten alles verbessern, es ist nicht unsere Schuld, wenn die Industrie, wenn die großen Unternehmen (…), wir waren Teil der, der Bewegung. Sie haben uns unterbrochen, Ihr habt zu sehr auf euren Profit geschaut (…) sie haben noch hinzugefügt, dass wir nichts begreifen, dass wir an unseren Privilegien kleben, und dann haben sie uns weggejagt wie Ganoven.“
Auf historischen Fakten beruht die Erzählung „Der Vorname“. Ort der Handlung Chambon-sur-Lignon in den Cevennes, bekannt dafür, dass seine Einwohner im II. WK. während Nazibesatzung und Vichy-Regime Tausende von Juden vor dem sicheren Tod bewahrt haben. Anführer waren Pastor André Trocme und sein Cousin Daniel, 1944 in Majdanek ermordet. Ihnen steht in der Geschichte Henri, der Steinschneider gegenüber, stellvertretend für Unzählige allerorten; und der will keine Juden bei seiner Familie verstecken. Durchaus empfänglich für Schönheit und Harmonie der Natur will er vor der „fremden“ Sprache, den Klagelauten eines Juden, der schwerverletzt unter einem eingestürzten Mäuerchen in seinem Steinbruch liegt, jedoch die Ohren verschließen. Die Wandlung, die aus Henri, dem Gleichgültigen, Feigling, Mitläufer einen empathischen Retter macht, der kein Zögern kennt, ist auf immer geborgen in diesem „Gefühl von Brüderlichkeit, das wie eine warme Kugel in uns zurücklässt“. Ein Vermächtnis. Wegzehrung für unsere Zukunft.
In „Die Pinklerin“ treffen Welten aufeinander. Doch die Welt, behauptet Youssef, der „den Umwälzungen des Planeten folgt, „ist winzig geworden“, es braucht einen Mittelpunkt. Der heißt für ihn: Marseille. „Sein Herzensort aber ist für immer Marrakesch“. Er ist Enkel eines Sufi, der sich in „seinem mystischen Tanz immer auf der Stelle drehte“. Youssef schildert Boris, der „manchmal einen Teil des Wegs bis Alicante mit ihm zurücklegt“ - beide schmuggeln Gebrauchswaren aus den reichen Ländern in den Maghreb - sein lebensumwälzendes Erlebnis, das für ihn selbst ganz unglaublich ist. Youssef steht am Zoll, es ist heiß. Da entdeckt er neben einem Auto in der Schlange eine Frau, kauernd, den Rock hochgezogen, die ihm in die Augen sieht, während sie pinkelt: „Er sieht - erahnt - den goldenen Strahl zwischen ihren Schenkeln. (…) Zum ersten Mal ist die Welt stehengeblieben, als hätte mein Großvater endlich innegehalten, (…) als hätte mein Blick sich auf ein Stück Ewigkeit gerichtet“. Boris hat nie einen einzigen Moment geglaubt, „dass die Welt oder die Zeit stehen bleiben könnten, dass das Exil ein Ende finden würde“. Seit er gesehen hat, wie die uralte Brücke von Mostar zerstört wurde, weiß er auf immer, „dass man mit den Grenzen spielen muss“. Er sieht nicht, was Youssef sieht, für ihn gibt es keinen Mittelpunkt oder Herzensort mehr. „Ich war muslimischer Bosnier, mein Nachbar orthodoxer Serbe, meine Verlobte Kroatin, wir wussten es kaum noch, wir hatten es vergessen. Dann die unendlichen Teilungen und jeder beschwört die Erinnerung an seine Andersartigkeit, jeder will zum Mittelpunkt werden. …Mein Mittelpunkt ist in tausend Teile zersprungen.“
Am Ende war die blonde Frau verschwunden. „Wäre sie wortlos in mein Auto gestiegen, ich hätte alles zurückgelassen, meine Frau, meine Kinder.“
***
Belinda Cannone, 1958 von korsisch-sizilianischen Eltern in Tunis geboren, wuchs in Marseille auf, lebt in Paris und in der Normandie. Sie ist eine der großen kritischen Stimmen Frankreichs. Ihre Themen: Feminismus, Antisemitismus, Rassismus. Vielfach preisgekrönt, u.a. Premier essay der Académie Français für „L’Ecriture du désir“. 2020 erschien in der Edition Converso ihr erfolgreicher Roman „Vom Rauschen und Rumoren der Welt“, nach dem der WDR ein Hörspiel produziert hat. 2025 außerdem: „Comment écrivent les Écrivains“ (Thierry Marchaisse); und im Okt. in der Reihe „Eine Nacht im Museum“, hier MUCEM, Marseille, ihr autobiografischer Roman „Venir d’une mer“ (STOCK).
Belinda Cannone kommt im Oktober auf Lesereise nach Deutschland: Freiburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart. Signierstunde am 17.10. auf der Frankfurter Buchmesse – zusammen mit Fabio Stassi – 3.1. A 101. Weitere Infos folgen auf www.edition-converso.com
Bitte beachten Sie auf www.edition-converso.com Belinda Cannones "Apologie der Kurzgeschichte oder Von den Verbindungen zwischen Erzählung und Poesie" (© Belinda Cannone) (Text wird derzeit übersetzt, ab 21.7. finden Sie die deutsche Version an dieser Stelle)

Belinda Cannone
Auf einem dünnen Seil
Erzählungen
Aus dem Französischen v. Claudia Steinitz, Tobias Scheffel
Seitenzahl: 176S.
Preis: 23,- € / 23,70 € [A]
Hardcover
ISBN: 978-3-949558-42-9
ET: Juli 2025
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Der neue Stassi ist da!
Plötzlich war ich das Buch und jeder hätte mir meine Geschichte vom Gesicht ablesen können, woher ich kam, wohin ich fuhr und alles, was mir an diesem Tag passiert war.
Vince Corso, von Beruf Bibliotherapeut, „einer der originellsten Detektive in der Krimigeschichte“, will für eine Weile seine “Literarische Erste Hilfe“ in der römischen Via Merulana zusperren, für eine Auszeit nach Neapel fahren und seine Verlobte Feng treffen. Auf der Fahrt bedrängt ihn ein mysteriöser Alter mit neugierigen Fragen, bis klar wird: Vince sitzt im falschen Zug. „Der Moment ist gekommen, diese Reise zu machen“, raunt sein Gegenüber. Und diese bringt ihn an die Orte seiner Kindheit, Genua, Nizza, die Côte d‘Azur und mitten in die schwierigste Ermittlung seines Lebens. Die er vor Jahren voller Zweifel und Verzweiflung, auch Wut und Anklage begonnen hat: mit Postkarten und einem Brief an den unbekannten Vater; adressiert an das mythische Hotel Negresco, wo seine Mutter arbeitete und der Unbekannte mindestens eine Nacht seines Lebens verbracht haben muss. Auf seiner letzten Station in Marseille wird er auf ungeahnte Weise fündig.
Mit dem typischen Grundton nie verklingender Melancholie und in magischen Farben geht Fabio Stassi inmitten der wiederauflebenden Pracht und der eigentlichen Schönheit, der der grenzenlosen Menschlichkeit, den grundlegenden Fragen des Menschseins sein nach: unsere Identität(en), die Rolle der Erinnerung, die Unvollkommenheit, die Scham und die Liebe.
***
Fabio Stassi, aus einer Familie von Weltenwanderern mit Ankerpunkt Sizilien, lebt in Viterbo und arbeitet als Direktor der Orientalischen Bibliothek an der Universität La Sapienza in Rom. Sein großes Werk, zuletzt Bebelplatz. La notte dei libri bruciati, ist mit vielen Preisen gewürdigt, zuletzt Hermann-Kesten-Preis (2024) des deutschen PEN für sein unermüdliches Engagement gegen Neofaschismus und Populismus: Literatur ist lebensrettendes Werkzeug und als solche immer schon eine Art der Abweichung – weshalb sie auch verfolgt wird. „Das kleine Licht der Vernunft“ am Leben zu halten – das treibt ihn an. ((hier die Pressemitteilung Preisverleihung PEN, aus Worüber sich noch freuen“)
In der Edition Converso sind bislang erschienen: Die Detektivromane (Ü Annette Kopetzki): Ich töte wen ich will (2022); Die Seele aller Zufälle (5. Aufl. Dez. 2024); sowie der Essay (Ü Monika Lustig) Ich, ja ich werd Sorge tragen für dich – Kurze Abhandlung über Dante, die Dichtung und den Schmerz (2024).

Fabio Stassi
Das Ausmaß von Liebe
Detektivroman
Ü Annette Kopetzki
Seitenzahl: 122S.
Preis: 22,- €/22, 60 € [A]
mit farbigen Abb., Hardcover
ISBN: 978-3-949558-43-6
ET: Mai 2025
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
„Trauben schwarz wie Blut“ - von Livia De Stefani, der endlich wiederentdeckten, sizilianischen Schriftstellerin
Als 1953 La vigna di uve nere, Livia De Stefanis erster Roman, erschien, war der Publikumserfolg enorm und gleichermaßen ein Skandal: Man stürzte sich auf den Inzest zwischen Bruder und Schwester, den Erzählmittelpunkt, und auf die Tragödie, die sich nach dem grausamen Willen des machtberauschten Vaters daraus entspann.
Das eigentlich Skandalöse war: hier erkühnte sich eine Frau, eine Sizilianerin, mit profunder Kenntnis patriarchaler Gesellschaftsstrukturen über deren vollendete Manifestation, die Mafia zu schreiben. Für die katholische Kirche existierte die Mafia gar nicht. Ernesto Ruffini, der Erzbischof von Palermo, war ein „unbeugsamer Verfechter der Nicht-Existenz der Mafia“; er ist leicht in der Figur des hohen Prälaten in Leonardo Sciascias „Tag der Eule“ von 1961 zu erkennen - in dem Roman, der bislang als erstes Erzählwerk über die Mafia galt. Die Rezeptionsgeschichte von „Trauben schwarz wie Blut“ erläutert auch das Nachwort „Schwarze Trauben und der Orangenbaum der Erkenntnis“ von Klaudia Ruschkowski und Monika Lustig.
1984 wurde der Roman mit Mario Adorf in der Hauptrolle auch verfilmt.
1920er Jahre, der Nordwesten Siziliens, ein erstarrtes Land unter der Allmacht der Feudalherren und der Mafia, „voll der Archetypen und Rituale / verschlossene Menschen, verschlossene Welten“ (Carlo Levi, Vorwort zur 4. Auflage 1975).
Casimiro Badalamenti, ein Mafioso unteren Ranges, ist Besitzer eines Weinbergs mit schwarzen Trauben - materielles wie mystisches Zentrum seines Lebens. Allumfassend und schwarz ist auch sein Wille, in der Hierarchie der „ehrenwerten Gesellschaft“ aufzusteigen; selbst um den Preis, seinen Weinberg für lange Zeit aufzugeben. Aus obskuren Gründen verlässt er Giardinello, was unmittelbar nach der Ermordung seines Vaters und seines Bruders geschah. Er zieht in den Küstenort Cinisi, „in die Fremde“, nistet sich in seiner Demütigung und Ohnmacht bei Concetta ein, „angezogen wie eine Fliege vom Zucker“ von ihrem marmorweißen Fleisch. Mit Präpotenz und der Verlockung von Prunk und Wohlstand macht er sie, die bislang die Männer aus der Umgebung bediente, zu seiner alleinigen Geliebten. Sie unterwirft sich ihm in totalem Gehorsam, bis zum tragischen Ende.
Ihm zu gefallen, seine Mannesehre zu „verewigen“, überzeugt sie ihn, der eigentlich keine Kinder will, dennoch welche zu zeugen. Die vier Kinder entreißt Casimiro ihr schon wenige Tage nach der Geburt, gibt sie zu ihm verpflichteten Pächtern; ein jedes wächst unter sehr verschiedenen Bedingungen, ohne voneinander zu wissen, heran. Bis der Vater sie im Jugendalter wieder an sich nimmt: „Erst jagen sie uns fort“ begehrt Nicola, der Erstgeborene auf, „dann, wenn es ihnen passt, sammeln sie uns wieder ein, einen auf diesem Feld, eine auf jenem, wie Reste von der Ernte, wie Tiere, die man aus der Falle holt.“
Er heiratet Concetta, denn um als nunmehr gemachter Mann und gefürchteter Mafioso zurückzukehren zu seinem Weinberg, braucht es den Status der bürgerlichen, „heiligen“ Familie.
Livia De Stefanis hochliterarische Sprache mit ihrem kristallinen Schliff dringt tief vor in die innersten Mechanismen des Geschehens, in die Abgründe ihrer Figuren. „Mit einer unerschrockenen Leichtigkeit des Tons, der das gesamte Buch trägt, von der es seine Dynamik und Frische bezieht“ (Eugenio Montale), holt sie die Magie unter der Realität hervor und lässt uns diese Realität erschreckend klar erkennen. Indem sie gerade die weiblichen Figuren in ihrer komplexen Widersprüchlichkeit „weichzeichnet“, wird die männliche Hybris zu einem Modell, das uns heute schwärzer, machtberauschter denn je entgegenschlägt.
»Ich liebe dich und das genügt«, erwiderte Concetta.
»Das genügt nicht. Die Leute vom Meer lieben auf ihre Weise. Sie fühlen sich frei, ohne Wurzeln. Aber mein Element ist die Erde und ich werde dir noch Wurzeln sprießen lassen, mit Liebe oder mit Gewalt. Und dann pflanze ich dich ein, du wirst schon sehen. Du warst eine Alge und wirst zu einem Weinstock.
Nur die Natur und ihre Gesetze – im Roman symbolisiert von den Orangenbäumen am Brunnen, Inbegriff von Liebe und Reinheit – öffnen dem Zufall einen Spalt. Und alles kommt ans Licht. Hoffnung keimt. Auch in unserer heutigen Wirklichkeit. Wo freilich das Licht der Erkenntnis weiterstrahlen muss, hinein in die Sphäre des Handelns.
***
Livia De Stefani (1913, Palermo-1991, Rom), Erbin schon in jungen Jahren eines Feudalbesitzes bei Alcamo/Sizilien, flüchtete sie mit siebzehn aus der Enge der Palermitanischen besseren Gesellschaft, heiratete in Rom den Bildhauer Renato Signorini, von dem sie drei Kinder hatte. Früh bereits gab sie alles für ihr Schreiben, gefördert und geschätzt von Alberto Savinio, Elsa Morante, Alba de Céspedes, Carlo Levi et al., hatte sie auch das Glück, bei großen Verlagen zu veröffentlichen (Mondadori, Rizzoli). Im Jahr ihres Todes erschien ihr umwerfend forsch und humorvoll erzählter Memoir „La Mafia alle mie spalle“.

Livia De Stefani
Trauben schwarz wie Blut
Roman
übersetzt von Klaudia Ruschkowski
Seitenzahl: 256
Preis: 24,- € /24,70 € [A]
Hardcover
ISBN: 978-3-949558-44-3
ET: Mai 2025
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Was Dichtung uns heute zu sagen vermag:
Fabio Stassis „Kurze Abhandlung über Dante, die Dichtung und den Schmerz“
„Glückliche Italiener, die eine fliegende Apotheke ihr eigenes Erbgut nennen dürfen!“, so schreibt Ralph Dutli in seinem Nachwort zu Fabio Stassis Essay Ich, ja ich werd‘ Sorge tragen für Dich, einer Kurzen Abhandlung über Dante, die Dichtung und den Schmerz (Ü Monika Lustig). In seinem „Trostbuch“ wirft der Hermann-Kesten-Preisträger Stassi einen unorthodoxen Blick auf Dantes Leben und Werk, von der Göttlichen Komödie über die Rime bis zur Vita nuova, und geht dabei der Frage nach, was diese Dichtung so zeitgemäß macht: Wie sie sowohl unsere Ängste und Krankheiten diagnostizieren kann, welche ureigene Heilkraft ihr innewohnt. Widerhall finden dabei weitere Autoren (etwa Borges, Brodsky, Eliot, Leopardi, Mandelstam, Saba) genauso wie neue naturwissenschaftliche, anthropologische und psychologische Erkenntnisse.
Stassi zeigt uns Dante als Schlaflosen, Getriebenen, Exilanten, als verletzliches Individuum, das in seiner „Poesie des Herzrasens“ verschiedenste Entbehrungserfahrungen und körperliche Reaktionen darauf beschreibt. Die Imagination, die Benennung des Schmerzes und die Lautlichkeit der Sprachschöpfung dienen Dante zugleich als Therapie. Wobei es um mehr geht als das Individuum: Gesellschaftliche Übel werden gleichfalls kartographiert, das Private ist politisch. Durch literarische Spiegelung, durch Mitleid mit dem Anderen, zeigt Dante einen Weg für unser an Kommunikationsstörungen leidendes Miteinander. Seine Dichtung ist alles andere als Eskapismus, in ihr „brennt stets die Flamme der Freiheit“. So ruft Stassi uns mit Blick auf die heutige Lage voller Sorge zu: „Wenn die Dichter und die Schriftsteller und die anderen Bannerträger der Vernunft die Stimme verlieren, sind es die Diktatoren, die sie wiederfinden.“
Am eindringlichsten bringt Stassi uns Dante als „Gebrauchslyriker“ im Hinblick auf Primo Levi nah: In der Hölle von Auschwitz versucht Levi, dem Elsässer Jean als Italienischübung zu erklären, wie das Dante’sche Inferno unterteilt ist, und findet darin unerwartete Botschaften. „Ein Vers, auch nur ein einzelner, kann ein Leben retten, kann die uns abhandengekommene oder die uns genommene Menschlichkeit zurückgeben.“
***
Fabio Stassi, geb. in Rom in einer Familie von Weltenwanderern, ist Träger des Hermann-Kesten-Preises des deutschen PEN 2024. Im Mittelpunkt seiner literarischen Suche steht das Thema der mehrfachen Identität. Seine Vorbilder sind Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo. In der Edition Converso sind bereits seine Krimis bzw. Detektivromane Ich töte wen ich will und Die Seele aller Zufälle (Hotlist der unabhängigen Verlage 2024) erschienen.

Fabio Stassi
Ich, ja ich werd’ Sorge tragen für Dich. Kurze Abhandlung über Dante, die Dichtung und den Schmerz
Essay
Mit einem Nachwort von Ralph Dutli
Aus dem Italienischen v. Monika Lustig
Seitenzahl: 128 S.
Preis: 22,00 € [D], € 22,70 [A]
HC, Fadenheftung, Lesebändchen
ISBN: 978-3-949558-36-8 -33-7
ET: Oktober 2024
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Die Provinz als comédie humaine: Marino Morettis Die vorlaute Fischhändlerin
Ein Klassiker des italienischen 20. Jahrhunderts neu zu entdecken
Cesenatico, Romagna, in den 1920er Jahren. Andreanas verstorbener Mann, einst größter Fischhändler des Dorfes und wie alle seine Kollegen „ein Gauner und Gotteslästerer“, lässt seine Frau auf einem Berg Schulden sitzen, ihr zweiter Mann Mondo, „Fischhändler mit Gefühl, ein kurioser Widerspruch“, wird in die Rache-Intrigen einer Fischerstochter und Tänzerin verwickelt und verliert sich im riskanten Unternehmen einer Konservenfabrik. Und auch ihre Kinder, die Junglehrerin Anita und der schöne Fortunato, gehen nach unerwarteten Wendungen eigene Wege. Da nimmt Andreana, schwanger mit Mitte vierzig, ihr Schicksal selbst in die Hand und wagt den Schritt in die Männerdomäne Fischhandel.
In seinem Roman „Die vorlaute Fischhändlerin“ (erstmals erschienen 1935; 1982 verfilmt von Leonardo Cortese) führt uns Marino Moretti mitten hinein in die lebenspralle Welt des Meeresvolks an der italienischen Adriaküste, von Cesenatico über Comacchio im Po-Delta bis nach Chioggia und Venedig. Moretti, ein hierzulande noch zu entdeckender Klassiker des italienischen 20. Jahrhunderts, steht in der Tradition großer Romanciers wie Giovanni Verga, konzentriert sich jedoch mit unverwechselbar komisch-ironischer Note ganz auf die kleinen Leute, die derben Fischhändler, die gebeutelten Fischer, auch „Seelumpen“ genannt, und die Frauen, für die besonders einprägsam die Hauptfigur steht. Eine Welt im Umbruch, wo Motorboote, Fischimporte, aufkommender Tourismus und Generationenkonflikte das Bestehende in Frage stellen und zugleich eine anarchistische Tradition auch während des Faschismus widerborstig fortwirkt und jedes Pathos untergräbt. „Jemand zeigte auf die Landschaft, kommentierte Dörfer und Häuser, unterstrich, wie schwierig die Lage hier sei und was Sozialisten und Republikaner angerichtet hatten, und was die Priester, was die Frauen; vernünftig und friedlich waren offenbar nur die Fischhändler.“
***
Marino Moretti wurde 1885 in Cesenatico geboren, wo er 1979 auch verstarb. Der mehrfach preisgekrönte Autor (beim Premio Viareggio 1959 etwa „schlägt“ er Pasolini) tritt zunächst als Dichter im Kreis des crepuscolarismo hervor, der sich vom Schwulst des Fin de siècle abkehrt. Ab 1913 schreibt er mit beachtlichem Publikumserfolg zwanzig Romane, auch Erzählungen, Autobiographisches, Reiseberichte. 1925 unterzeichnet er das „Manifest der antifaschistischen Intellektuellen“. Der Fokus seines Schreibens liegt auf dem Leben in der Romagna; besonders charakteristisch sind seine Frauenfiguren. Sein Haus in Cesenatico ist heute ein Museum.

Marino Moretti
Die vorlaute Fischhändlerin
Roman
Aus dem Italienischen von Judith Krieg
Seitenzahl: 320 S.
Preis:24,00 € [D] | 24,70 € [A]
Klappenbroschur, Fadenheftung
ISBN 978 -3-949558 -33-7
ET: Juni 2024
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Mensch bleiben, trotz allem: eine Geschichte aus dem historischen Palästina
Ich, der Sohn von Giosuè Calaciura
„Offenbar ist Gott ein reiches, launisches Kind. Unser Leid ist für ihn ein Spiel.“ Dreißigjährig blickt Giosuè Calaciuras Protagonist, Jesus sein Name, auf sein Leben in einem Land zurück, das von der römischen Besatzung, Hungersnöten, vielfachen Verheerungen gebeutelt ist. Als Kind ist er mit den Eltern auf der Flucht, über seinem Heranwachsen schwebt ein Geheimnis, mit dem auch das plötzliche Verschwinden seines Vaters Josef zusammenhängt. Er macht sich auf die Suche, auf eine abenteuerliche Wanderschaft, unter anderem als Mitglied einer Gauklertruppe, auch um herauszufinden: Stimmt es, wie die Verwandten munkeln, dass seine schweigsame junge Mutter, die unausgesprochen große Erwartungen an ihn hat, von einem römischen Soldaten vergewaltigt wurde, er gar nicht der Sohn seines Vaters ist? Eine Gewalt, die sich fortpflanzt, ausbreitet, ihre Verwüstungen im äußeren Geschehen wie tief in der Seele fortsetzt.
Calaciura führt seinen empfindsamen, verletzlichen Protagonisten an Grenzen und darüber hinaus, lässt ihn das glühende Erwachen der Liebe, die frömmelnde Duckmäuserei der Erwachsenen, die grausame Ängstlichkeit der Herrschenden, den Fanatismus als Grundübel kennenlernen, aber auch mit existenziellem Verlorensein und seinen eigenen Dämonen kämpfen, mit dem, was „wild und unbezwingbar“ nur zum ihm gehört, „meine persönlichen Bestien, die aus mir herausbrechen würden, um nach den anderen zu schnappen“. Den Vater findet Jesus nicht, dafür aber vielfältig gespiegelte Vaterfiguren, kurzzeitig eine Frau, die sich den herrschenden Rollenbildern widersetzt, und zuletzt eine neuartige Gemeinschaft. Ein intensiver, sprachmächtiger Roman (Ü Judith Krieg) über einen, der vom Glauben abfällt, auch an die Menschen, und dennoch versucht, selbst Mensch zu bleiben. Eine Geschichte vom Verlieren, Loslassen, Überwinden – aber auch von der Schönheit und von der Hoffnung, die trotz allem unsichtbar in der Asche keimt.
***
Giosuè Calaciura, geb. 1960 in Palermo, Journalist (unter anderem für Rai 3), hat auch als Koch gearbeitet, und ist heute preisgekrönter Schriftsteller: „Auf den historischen Märkten in Palermo wurde ich mir der Dringlichkeit bewusst, einer Menschheit, die kein Gehör findet, als Erzähler eine Stimme zu geben.“ Sein Werk ist ins Spanische und Französische übersetzt. Auf Deutsch liegt bereits vor: Die Kinder des Borgo Vecchio (Aufbau).

Giosuè Calaciura
Ich, der Sohn
Roman
Aus dem Italienischen von Judith Krieg
Seitenzahl: 304 S.
Preis:24,00 € [D] | 24,70 € [A]
französische Broschur, Fadenheftung
ISBN 978 -3-949558 -20-7
ET: Juni 2024
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Blues im Mittherbst: Noir von Santo Piazzese in Erstübersetzung
Mit Lorenzo La Marca, dem Biologen und Hobby-Ermittler, hat Santo Piazzese eine Kultfigur mit unverwechselbarem Tonfall geschaffen. In „Blues im Mittherbst“, einem „Meeresnoir“, der nun zum ersten Mal in deutscher Übersetzung vorliegt, begleiten wir La Marca zurück in eine einschneidende Episode seiner Jugend, auf Forschungsfahrt mit einem Thunfischkutter und schließlich auf ein abgelegenes Insel-Archipel, wo Aussteiger aus der ganzen Welt leben und ihre Vergangenheit hinter sich lassen möchten – was aber nicht in jedem Fall gelingen wird.
Da ist etwa der Generalissimo, noch immer stolz auf seine Reliquien aus dem spanischen Bürgerkrieg, wo er auf der Seite der Falangisten kämpfte, während er später zum überzeugten Marxisten wurde; oder Ermanno Lombardi, der von einem Tag auf den anderen als „Fritz“ tituliert wird, da er an einen trinkfesten Bayern erinnere. Gravitationszentrum der Gestrandeten ist die Locanda Edelweiß, betrieben von Milocco, einem Mann aus dem Friaul, und Marianna, der „schönsten Frau auf Erden“. Während wir erleben, wie La Marca sich in die Insel verliebt, Ironie und Nostalgie sich im Rückblick vermengen, wobei wie immer auch Musik und Essen nicht zu kurz kommen, ist doch von Anfang an zu spüren, das im Zentrum der Erzählung eine Leerstelle, ein Geheimnis steht. Als Angiolini, ein halbseidenes, aber kaufkräftiges Subjekt, auf der Insel auftaucht, steigert sich die bisher subtil aufgebaute Spannung und es kommt zum Showdown. Nie wieder wird La Marca danach auf die Insel zurückkehren – sie wird zum Sinnbild der verlorenen Jugend in diesem „Portrait des Protagonisten als junger Mann“ (Santo Piazzese).
***
Santo Piazzese, 1948 in Palermo geboren und vielfach preisgekrönt, gilt neben Andrea Camilleri als der Vertreter des sizilianischen Krimis. Er lebt über den Dächern von Palermo, in unmittelbarer Nähe zu „seinen“ Tatorten und dem Verlag Sellerio editore. Sein Werk liegt in mehreren Sprachen vor. In der Edition Converso sind erschienen: Schirokko und (andere) heiße Verbrechen, Via Riccardo il Nero und die weiße Pelargonie, Blaue Blumen zu Allerseelen.
Santo Piazzese
Blues im Mittherbst
Aus dem Italienischen v. Catherine Hornung
Seitenzahl: 176 S.
Preis: 20,00 € [D], € 20,70 [A]
Ausstattung:Hardcover geb., mit Lesebändchen und bedrucktem Vorsatz
ISBN 978-3-949558-34-4
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Der Schatz der Großmutter: Mitgift von Antonela Marušić (Kroatien)
„Ständig kehre ich zurück und korrigiere das Geschriebene. (…) Man muss in einem fort rühren und rühren, damit die Soße nicht ansetzt. Wie bei der Šalša, die meine Oma und ich immer gegen Ende des Sommers aus geschälten und klein geschnittenen reifen Tomaten zubereitet haben.“ Nela, Protagonistin des Romans „Mitgift“ der kroatischen Autorin Antonela Marušić, wächst in Split auf und wird jeden Sommer allein mit dem Fährschiff zur Großmutter auf die dalmatinische Insel Korčula geschickt. Einerseits ihre Rettung, denn ihre alleinerziehende Mutter hat keine Zeit für Gespräche, ganz anders als die Oma, die nicht nur eine nach Wildkräutern und Acker duftende Bäuerin und Bewahrerin traditioneller Rezepte, eine eigensinnige Frau, die ihre Beine schlenkert „wie ein Cowboy“, sondern auch eine begabte Erzählerin ist: Die Geschichten aus ihrem von Armut geprägten Leben reichen weit zurück, bis in die Zeit des Partisanenkampfes und zur Deportation ins ägyptische El Shatt. Doch auch Gewalt wartet auf der Insel, etwa in Gestalt des Onkels, der gern einmal zum Gürtel greift, wenn das Kind nicht spurt. Schon früh keimt Widerstand in Nela: Sie schwört Rache, will ihre Herkunft hinter sich lassen – indem sie Schriftstellerin wird.
In einem unverwechselbaren Ton, poetisch und flapsig zugleich, durchzogen vom Aroma des Inseldialekts, zeichnet Antonela Marušić (Übersetzung: Marie Alpermann) das Porträt eines Mädchens, das zwischen verschiedenen Welten heran- und in ihr eigenes Leben, auch in ihre eigene sexuelle Identität hineinwächst. Das Gewebe des Erzählens vollzieht nach, wie wir zu dem werden, was wir sind – welche Worte, Gerüche, Klänge, Vorstellungen unser Inneres prägen und unser Leben lang nachwirken, was Heranwachsen bedeutet, samt allen Brüchen, Entfremdungen und Abschieden. Schwarz-Weiß gibt es hier nicht, neben der Fülle steht immer auch der Schmerz. Indem sie ihre eigenen Worte findet, wird es Nela schließlich gelingen, die Stimme ihrer Großmutter weiterklingen zu lassen. „Wäre ich eine Kameralinse, die über dem Lauf der Zeit schwebt, würde ich mich in die Zeit hinablassen, in der Oma und Enkelin dieser Geschichte wie zwei schaukelnde Barken Seite an Seite gingen. (…) »Die Tage verfliegen, die Jahre vergehn«, sagt Oma jedes Mal, wenn sie eine Geschichte zu Ende erzählt hat. Darauf gibt es nichts weiter zu sagen. Es bleiben nur die Hülsen der Gedanken zurück, die in der starken Nachmittagssonne trocknen.“
***
Antonela Marušić, Jahrgang 1974, Autorin von Romanen, Prosa und Gedichten, schreibt über Themen wie lesbische Intimität, LGBTIQ-Aktivismus und dem feministischen und queeren Kampf gegen die patriarchalische und konservative Gesellschaft im ehemaligen Jugoslawien. Ihre Werke wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Sie ist eine der Initiatorinnen des wichtigsten kroatischen feministischen Portals Vox Feminae. Derzeit ist sie als Journalistin und Redakteurin beim digitalen Fernsehsender Vida beschäftigt.
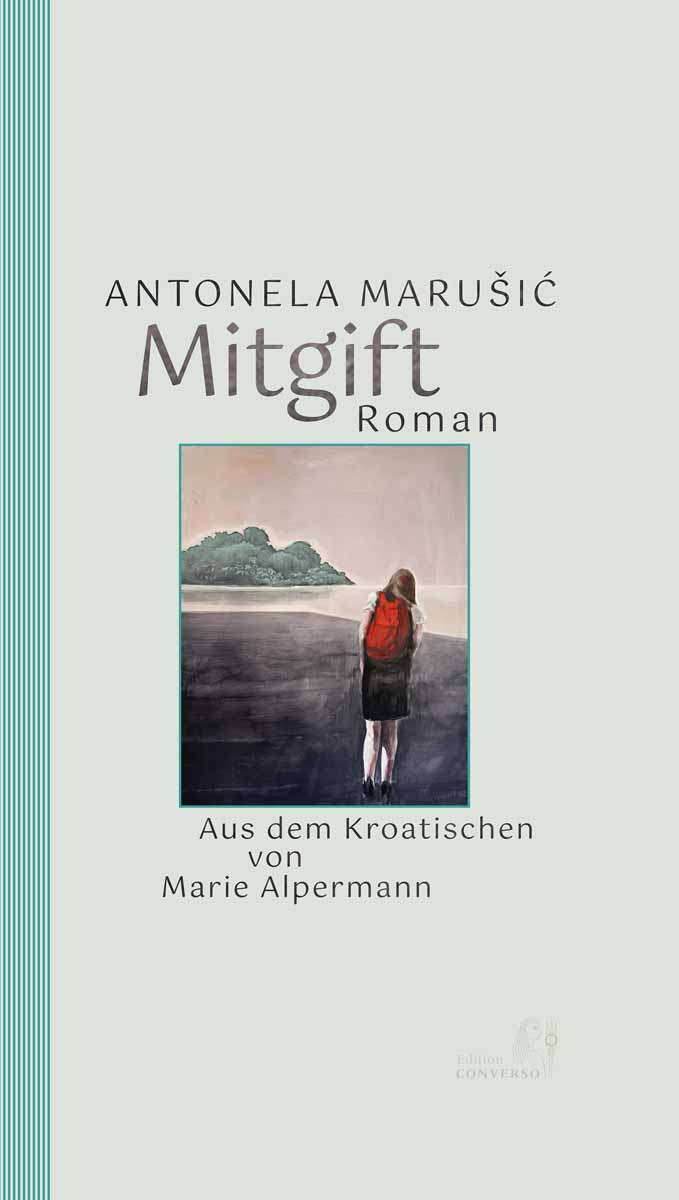
Antonela Marušić
Mitgift
Roman aus dem Kroatischen von Marie Alpermann
Seitenzahl: 224 S.
Preis: 22 € [D], 22,70 € [A]
Hardcover geb., mit Lesebändchen und bedrucktem Vorsatz
ISBN 978-3-949558-21-4
ET: 9. Februar 2024
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Eine literarische Spurensuche mit dem römischen Bibliotherapeuten Vince Corso
„Wenn du alles verloren hättest, und dir nur eine einzige Erinnerung gestattet wäre, welche würdest du wählen?“ Diese Frage steht im Zentrum von Fabio Stassis Detektivroman um den Bibliotherapeuten Vince Corso, der in seiner Dachgeschosswohnung in der römischen Via Merulana Patienten, meist Frauen, mit Buchempfehlungen zu kurieren versucht. Eines Tages stellt eine Besucherin ihn vor ein schier unlösbares Rätsel: Ihr an Alzheimer erkrankter Bruder, ehemals ein großer Bibliophiler und Weltreisender, wiederholt immer wieder gewisse Sätze – womöglich Zeilen aus einem Buch?
Vince erhält Zugang zur Wunderkammer-Bibliothek des Alten und gerät immer tiefer hinein in ein Labyrinth aus unendlich kombinierbaren Zeichen, Verdachtsmomenten und unvermeidlichen Zufällen. Hat der Alte in besagtem Buch sein Testament versteckt, braucht er Vinces Hilfe? Was hat es mit der schönen und klugen Chinesisch-Lektorin Feng auf sich, deren Bekanntschaft Vince bald macht? Vince wird fündig, aber auf andere Weise als vermutet: Am Ende wartet er auf ein Gespenst, im Esquilin, dem Viertel der „Alchimisten und Geistererscheinungen“. Und das Gespenst wird kommen. Eine raffiniert angelegte, schwindelerregende Spurensuche durch ein Rom jenseits der Klischees, und eine Hymne auf die Literatur, die dem flüchtigen Stoff der Erinnerung ein Zuhause bietet. Dabei gilt das Motto, dem Vince sich erfolgreich anvertraut: „Du musst quergehen, Vince. Der falsche Weg ist der Richtige.“
***
Fabio Stassi, geb. in Rom in einer Familie von Weltenwanderern, stellt das Thema der mehrfachen Identität in den Mittelpunkt seiner literarischen Suche. Seine Vorbilder sind Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo. 2022 erschien in der Edition Converso bereits ein erster Band um Vince Corso, Ich töte wen ich will.
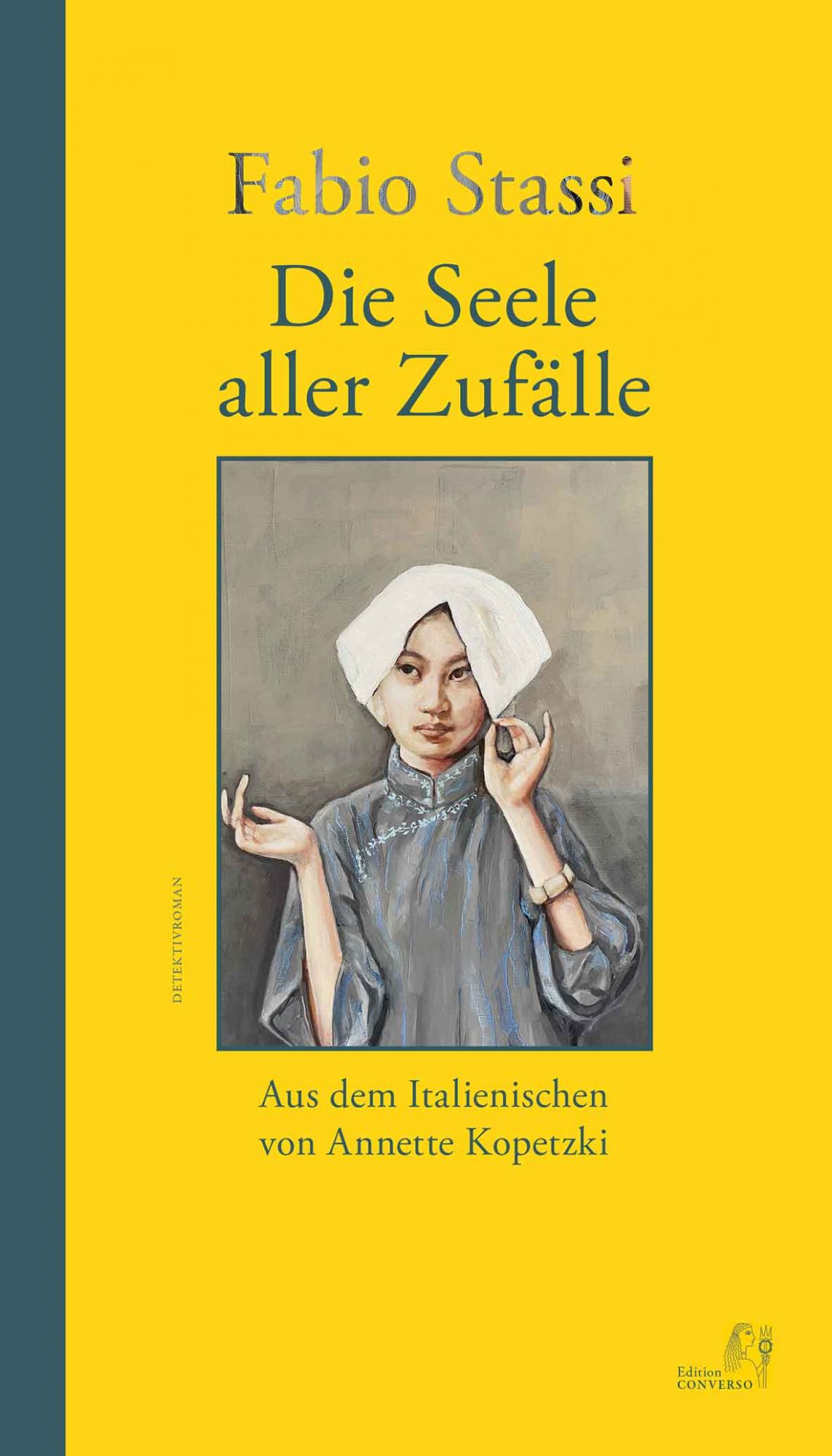
Fabio Stassi
Die Seele aller Zufälle
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Seitenzahl: 288 S.
Preis: 24 € [D], 24,70 € [A]
ISBN 978-3-949558-30-6
ET: 3. Januar 2024
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Was in Leib und Seele eingeschrieben ist: Tief ins Fleisch von Yasmine Chami
„Er ahnte, dass ihm die sich nun ankündigende Welt fremd sein würde, aber er trug in sich das Gewicht der früheren Geschichte, die kostbare Erinnerung“ – das erkennt Ismaïl, Koryphäe der Neurochirurgie in Rabat, der seine Frau Médee, Bildhauerin, nach über dreißig Jahren Ehe für eine Jüngere verlässt und damit auch das Verhältnis zu seinen drei Kindern neu ausloten muss. Die vermeintlich bekannte Konstellation um Liebe, Leidenschaft und Verrat entfaltet in Yasmine Chamis Roman „Tief ins Fleisch“ eine frische, aufwühlende Kraft, wird zum Porträt verschiedener Generationen im Marokko der letzten Jahrzehnte, wo Altes und Neues, Freiheitsdrang und Unterdrückung aufeinanderstoßen, sich in die Körper der Menschen einschreiben, ihre scheinbar bewussten Entscheidungen beeinflussen. Genau das sieht Ismaïl immer klarer, während sein bisheriges Leben auseinanderdriftet: Seine neue Liebe Meriem, eine brillante junge Kollegin, Tochter einer kämpferischen Feministin, besitzt eine Unabhängigkeit, die ihm so bisher nicht bekannt war; seine Frau Medée entpuppt sich als Anti-Medea, findet in der Trennung zu neuer schöpferischer Kraft; und immer deutlicher ragt der große, traumatische Verlust seiner Kindheit in die Gegenwart hinein: Sein Vater, ein Wissenschaftler und Wahrheitsliebender, wurde eines Tages von der Geheimpolizei abgeholt und kehrte nie wieder zurück. Ismaïl, der bei Gehirn-OPs um das Erinnerungsvermögen seiner Patienten ringt, erkennt seine eigenen blinden Flecken. „Seine Kindheit war von dem Gefühl geprägt, dass es unter der harmonischen und strahlenden Stadt eine andere gab, die unter ihren Füßen lauerte wie ein Ghul, jenes Fabelwesen, das die Menschen verschlang und vernichtete.“ Eine Geschichte mit unerwartetem Ende um das, was unser Menschsein ausmacht, und das Bild eines Landes von großer Schönheit und Tragik.
***
Yasmine Chami, Autorin zahlreicher Romane, war Dozentin für Anthropologie in Paris und Leiterin des Museums Villa des Arts in Casablanca; sie gründete eine Produktionsgesellschaft und arbeitete als TV-Redakteurin über Entwicklungen der marokkanischen Gesellschaft. Sie stellt die für Marokko enorm politische Frage nach den Geschlechterverhältnissen; nicht zuletzt die, was das Patriarchat mit den Männern macht. All ihre Bücher spielen in Marokko; für Mourir est un enchantement erhielt sie 2017 die Kategorie Sonderpreis des Arabischen Literaturpreises.
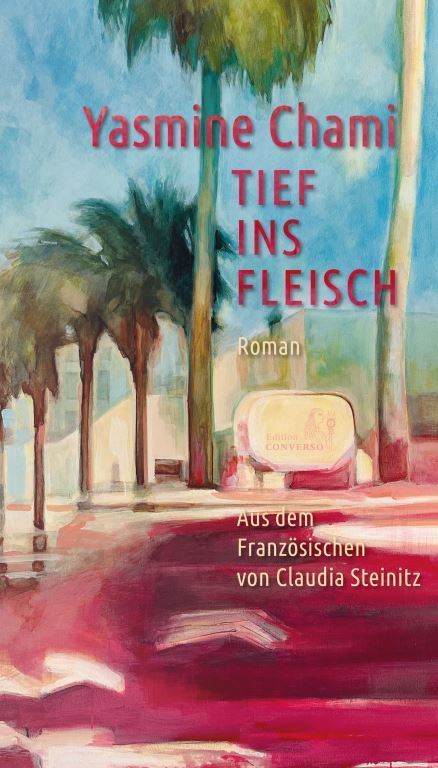
Yasmine Chami
Tief ins Fleisch
Roman aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Seitenzahl: 192 S.
Preis: 22,80 € [D], 23,50 € [A]
ISBN 978-3-949558-31-3
ET: 3. Januar 2024
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Santo Piazzese: Schirokko und (andere) heiße Verbrechen
„Und so kam es, dass ich an jenem Morgen beim ersten Löwenbrüllen, die Nase an der Scheibe, nach draußen schaute und mir das Wort mit sieben Buchstaben von der Zunge rollte, das jeder Sizilianer, der etwas auf sich hält, mindestens hundert Mal pro Tag schreit, flüstert, in abgehackter oder abgeschwächter Form einfließen lässt. Und es ist das Mindeste, das einem beim Anblick eines Erhängten rausrutschen kann.“
Lorenzo La Marca, Biologe, Dozent an dem mit allen Lastern gesegneten Biochemie-Institut, daselbst passionierter Detektiv, lebt in absoluter Symbiose mit seiner Stadt, Palermo, die sich alles, was ihr unterkommt, zerstückelt, absorbiert, in ihren Stoffwechsel einspeist. In der unwiderstehlich ironisch-schäumenden, humorig-sarkastischen Sprache Piazzeses jedoch wird Palermo mit all seinen grellen Gegensätzen zu einem scheinbar form- und beherrschbaren Kosmos; entzieht sich dennoch wieder, um so seine volle, zeitlose Faszination zu entfalten.
Erstmals 1996 bei Sellerio editore Palermo (dem von Leonardo Sciascia mitbegründeten Verlag) erschienen, ist dieser Krimi mit bislang 42 Neuauflagen ein echter Kult: Es waren die Jahre nach den Mafia-Attentaten auf die Richter Falcone und Borsellino – eine klare Zäsur des zivilgesellschaftlichen Lebens, Teile des Mafia-gestützten Staats unter Beschuss. Wie festzementiert (bis heute?) das Bild: „Palermo – Hauptstadt der Mafia“. Das „andere“ Palermo zu erzählen, war ein Akt des Widerstands.
Samstagfrüh. Heftiger Schirokko bläst. La Marca entdeckt vom Fenster seiner Arbeitsklause aus am Ficus magnoloidis inmitten der Botanischen Gärten einen Toten. Sofort ruft er den Bullenfreund Spotorno, stets im scharfen Schlagabtausch die beiden, wahre Männerfreundschaft eben. In seinem Tross, Michelle Laurent, die Gerichtsärztin, La Marcas verflossene Liebe. Die Rituale der Wiederannäherung – ars sicula amatoria. Eine Augenwischerei. Als sich die Identität des Opfers herausstellt, gibt es für den Detektiv in ihm kein Halten mehr. Auch weil eine Blondine aus Iowa, die Beinah-Witwe, auftaucht. Eine zweite Bluttat geschieht, unweit vom Ficus. Mit köstlich genährtem Spürsinn trägt La Marca das dichte Flechtwerk aus Neid-und-Eifersucht, Karrieregeilheit und typisch sizilianischer Kastenmentalität ab: Die kriminelle Energie in den erlauchten Kreisen hat sich mit Raffinesse der Topergebnisse der Naturwissenschaften bedient. Höchst aktuell.
***
Santo Piazzese: Via Riccardo il Nero und die weiße Pelargonie
“Wir verschwanden im Straßenlabyrinth am Flohmarkt längs des Seitenbaus des Palazzo Santa Rosalia, der heutigen Kunstakademie. Der Tote lag ein Stück weiter. Dort wimmelte es nur so von Polizisten. Es schienen viel mehr, als es in Wirklichkeit waren, was auf einer optischen Täuschung aufgrund der räumlichen Enge rings um den sogenannten Tatort beruhte. Kein Zweifel, dass dies der Tatort war: Da war ein riesiger See von Blut; es mussten wesentlich mehr als die fünfeinhalb Liter sein, die laut der heiligen Schriften der Wissenschaft in einem Standardleib zirkulieren.“
Dieser Roman „entstanden wie durch ein ‚Auskeimen‘ aus dem vorigen [Schirokko und (andere) heiße Verbrechen] offeriert eine Sicht auf Palermo, die als anormal definiert wurde“, so der Autor in seinem Vorwort zu Blaue Blumen zu Allerseelen – die alle drei nun die TRILOGIE VON PALERMO bilden und die in Italien in mehreren Auflagen seit 2009 verlegt wird. Auch hier ist die Mafia aus dem Zentrum des Romangeschehens verbannt und doch als Schatten in den palermitanischen Belangen präsent.
Lorenzo La Marca, verbissener Biologe, Detektiv aus Notwendigkeit, ist von einem herbstlich-existenzialistischen Blues heimgesucht. Bei strömendem Regen begleitet er den Freund, Kommissar Spotorno, zum Tatort. Das Herz des Toten auf dem Gehsteig von einem Revolverschuss durchbohrt. Michelle Laurent, die Gerichtsärztin, hat sich endlich von ihrem aufgeblasenen Ballon getrennt, und verbringt nun viel mehr Zeit mit La Marca, was diesem beinahe zum Verhängnis wird. Mediterrane Familienbande sind besonders verbindlich. Ihr Vater, ein Marseiller Charmebolzen, kannte den Toten, den international agierenden Antiquitätenhändler Umberto Ghini. Er kannte aber auch dessen Frau. La Marca will sich Zeit lassen bei seiner Philosophie der kontemplativen Aperitifs, acqua con zammù inbegriffen, und viel Jazz – das Chet Baker gewidmete Kapitel ist eine höchstpoetische Hommage. Doch als er beruflich nach Wien reist, gilt sein ganzes Interesse dem Ghini’s, der Zweigstelle, und einer forschen „Ugro-Finnin“. Mit der Austro-Sizilianischen Connection erweist sich La Marca, Piazzeses Alter Ego, als Meister psychologisch tiefgängiger Spannung.
Santo Piazzese, 1948 in Palermo geboren, gilt neben Andrea Camilleri als d e r Vertreter des sizilianischen Krimis. Er lebt in einem Bermudadreieck zwischen den wechselnden Tatorten und seinem Verlag Sellerio editore. Die beiden Romane sind rundherum neu übersetzt und mit einer Übersetzernote sowie hilfreichen Anmerkungen versehen. Sie bilden zusammen mit den 2019 als No. 1 bei Edition Converso erschienenen Blaue Blumen zu Allerseelen - nun die „TRILOGIE VON PALERMO“. 2024 erscheint zum Gastlandauftritt Italiens in der Edition Converso Piazzese Noir Blues im Mittherbst.
Sein Werk wurde mit vielen Preisen bedacht, auch ins Französische und Spanische übersetzt; ist Gegenstand vieler Doktorarbeiten ringsum den Globus.
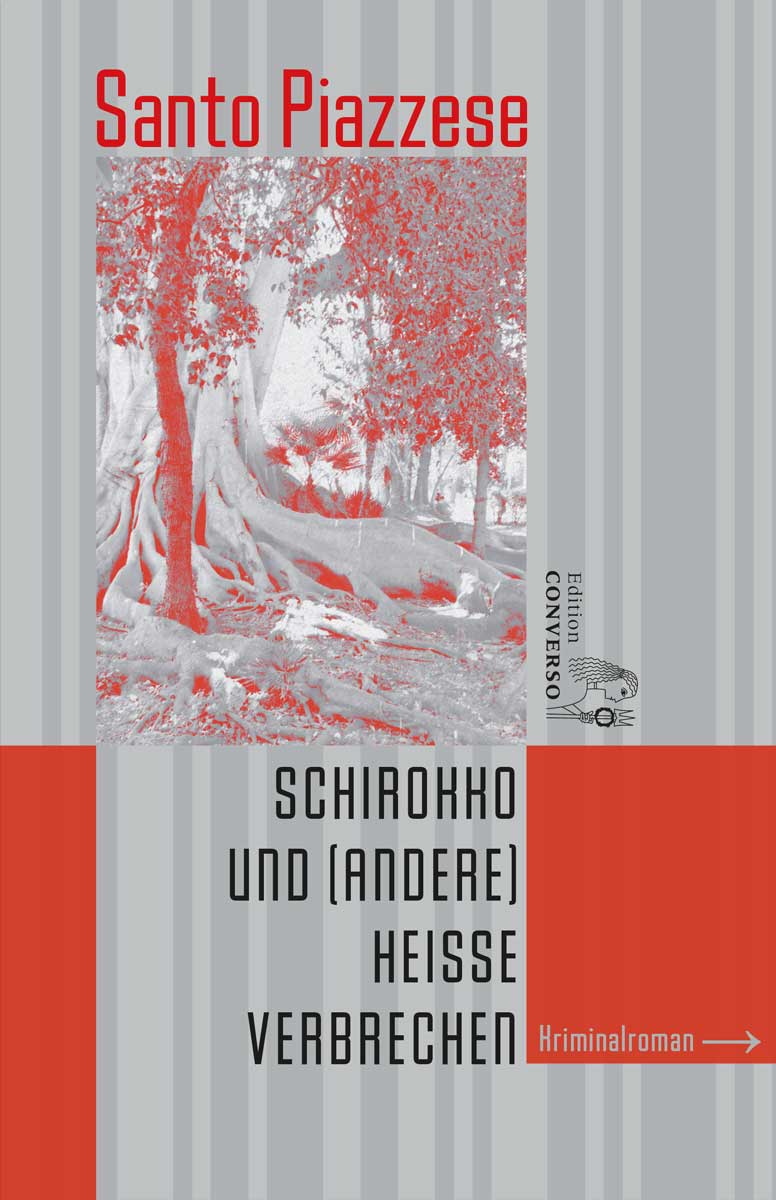
Santo Piazzese
Schirokko und (andere) heiße Verbrechen
Neu übersetzt aus den sizilianischen Italienisch und mit einer Übersetzernote von Monika Lustig
Seitenzahl: 336 S.,
Preis: € 24,00 [D] / € 24,70 [A]
ISBN 978-3-949558-23-8
ET: August 2023
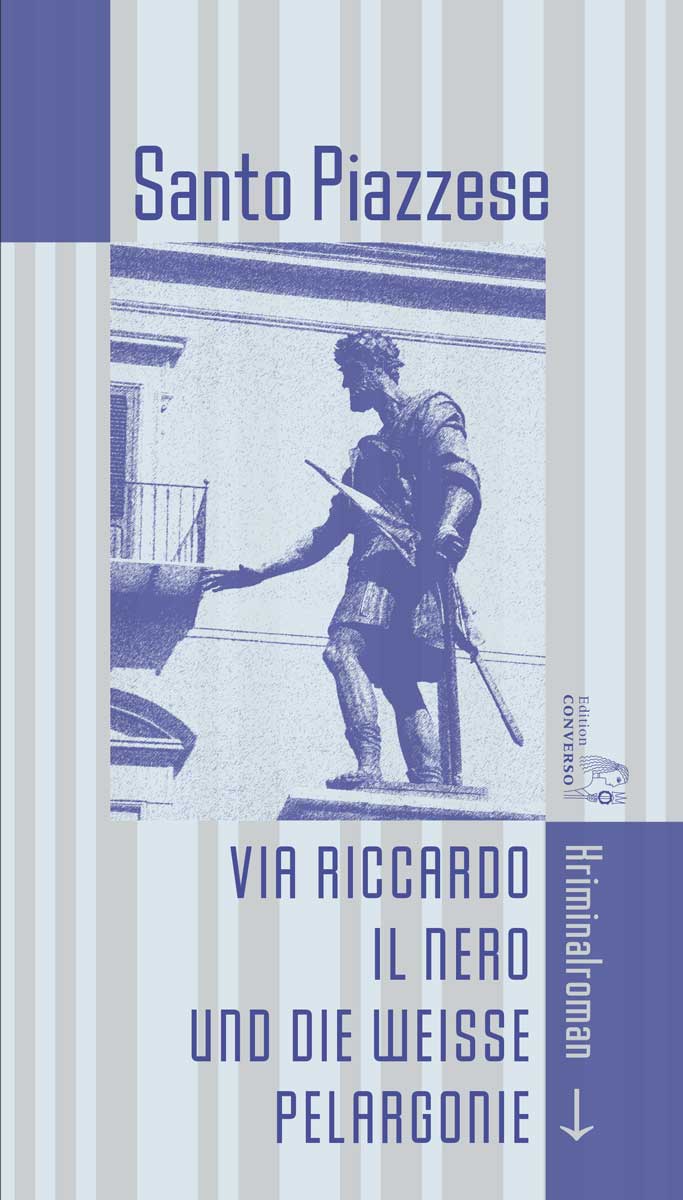
Santo Piazzese
Via Riccardo il Nero und die weiße Pelargonie
Aus dem Kroatischen von Alida Bremer
Seitenzahl: 368 S.,
Preis: € 24,00 [D] / € 24,70 [A]
ISBN 978-3-949558-24-5
ET: August 2023
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechte Buchcover herunterladen]
Edi Matić: Abtrünniger vor Inselpanorama
Ein Roman von den kroatischen Inseln
„Jeder, der in der Stadt lebt und in einem gewissen Alter ist, hat zumindest einmal den Wunsch verspürt, sich in den Wald abzusetzen, Walderdbeeren zu pflücken, sich in einer Berghütte umringt von einer Schafherde niederzulassen; oder sich auf einer einsamen Insel zu verstecken und morgens von einer Barke aus gemächlich seine Angel auszuwerfen. Doch während dieser Wunsch in den meisten Fällen ein Traum bleibt, habe ich versucht, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.“
Von einem Tag auf den anderen ist Leibwächter Jadran Grobarek auf der Flucht: Er wird Zeuge, wie der von ihm bewachte Politiker eine Kollegin ermordet. Allen ist klar: Jadran wird nicht schweigen. Ein Franziskaner, alter Bekannter aus Jadrans Kindheit, verpasst dem Flüchtenden ein Mönchsgewand, schickt ihn auf die Insel. Auf eine „unentdeckte“, vom Festland so gut wie vergessene Insel vor der dalmatinischen Küste, bevölkert von einer eingeschworenen Gemeinschaft. Wird er dort unentdeckt bleiben? Zusammen mit dem falschen Priester führt der kroatische Autor Edi Matić uns mitten hinein in eine betörende Atmosphäre, überlässt uns dem Rhythmus der Insel, macht uns zu ahnungsvollen Komplizen.
Nach und nach erobert sich Jadran Grobarek das Vertrauen der Insulaner, die ihm mitsamt ihren Eigenarten und Liebenswürdigkeiten ebenfalls ans Herz wachsen: Da ist etwa der lebenserfahrene Don Marko, der nicht nur seine Kirche, sondern auch die irdischen Geschicke der Insel im Blick hat und dabei ganz eigene Pläne für sein weiteres Leben verfolgt. Da sind Fischer und Inselphilosophen, ehemalige Partisaninnen, Kriegswitwen, elegante Kapitäne und – nicht zu vergessen – liebesbedürftige Hobbyfotografinnen. Viele der einstigen Bewohner haben die Insel verlassen, leben als Auswanderer in der ganzen Welt verstreut, die leerstehenden Häuser sind nur im Sommer von Touristen und kurzzeitigen Rückkehrern belebt. Aus dem alten Schulhaus wollen zwei Inselbewohnerinnen ein Kulturzentrum machen: bis sich eines Tages eine von ihnen auf ein falsches Spiel international aufgestellter Geldwäsche-Betrüger einlässt … die langen Arme der globalisierten Welt mit ihren Offshore-Geschäften und dem Erstarken nationalistischer Kräfte machen auch vor der Insel nicht halt. Dennoch ist sie die eigentliche Protagonistin dieses Romans: Hier verschieben sich die Perspektiven, das Kleine wird groß und das Große klein, der Tintenfischfang, der Respekt vor dem Meer, aber auch das Geheimnis eines guten brudet (Fischsuppe) bestimmen den Tag, wir erfahren von alten Mittelmeersprachen und der fjaka, der dalmatinischen Variante der Siesta, und eine Utopie scheint auf, zumindest für die Dauer der Lektüre.
Edi Matić ist 1962 in Split geboren. Im Krieg Leiter einer humanitären Friedensorganisation in Kroatien/Bosnien-Herzegowina. Im Vorstand des kroatischen Schriftstellerverbands; Ehrenmitglied des P.E.N. Bosnien-Herzegowina. 2023 erhält er den renommierten kroatischen Theaterpreis „Marin Držić“. Romane, Essays, Lyrik; Erzählungen in Anthologien und Zeitschriften in Kroatien, Österreich, Montenegro, Türkei, Deutschland, Bulgarien, Mazedonien.
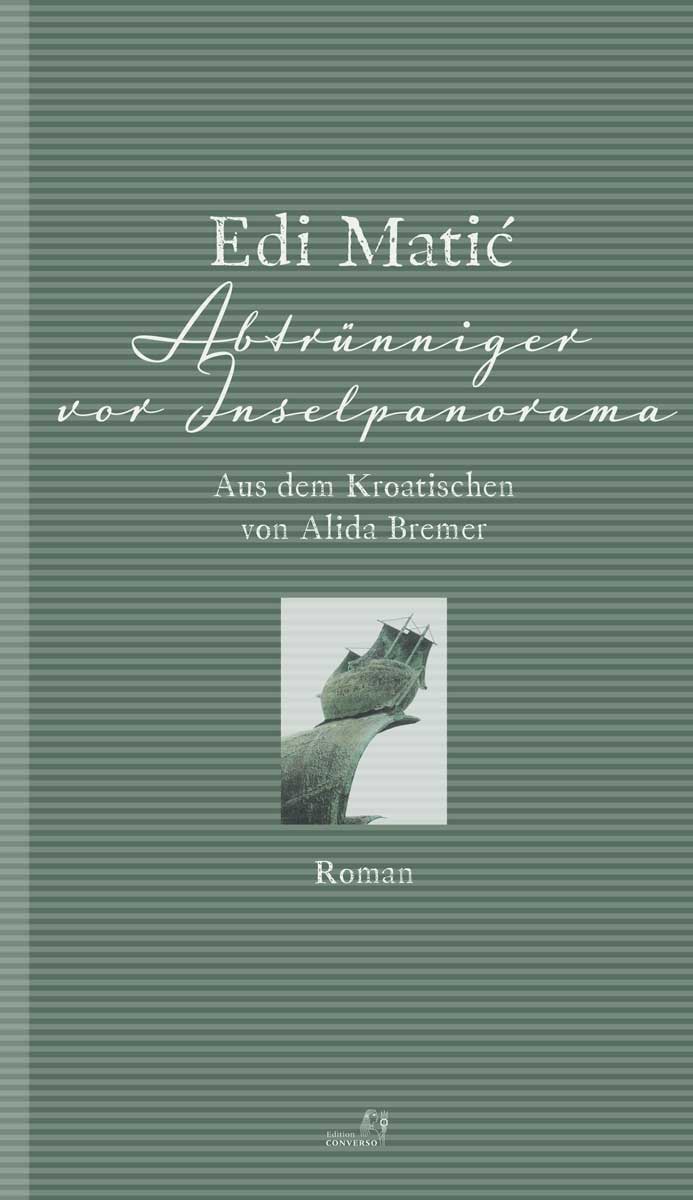
Edi Matić
Abtrünniger vor Inselpanorama
Aus dem Kroatischen von Alida Bremer
Seitenzahl:253 S.,
Preis: € 24,00 [D] / € 24,70 [A]
ISBN 978-3-949558-19-1
ET: ET: Juni 2023
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]

Die Affaire Moro. Ein Roman:
Leonardo Sciascia in Neuübersetzung
Das Buch des großen sizilianischen Autors Leonardo Sciascia richtet ein schneidendes Licht auf die italienische Affaire: die Entführung und Ermordung (16.3.–9.5.1978) Aldo Moros, Mächtiger der Democrazia Cristiana (mehrfach Minister, Ministerpräsident; Parteivorsitzender) von Hand der Brigate rosse (und auf die Ermordung seiner vier Personenschützer). Sciascia, das Gewissen Italiens, wollte anfangs schweigen, den übermächtigen Medien kein Futter liefern. Die Entdeckung eines Glühwürmchens war der Funken an der Zündschnur: Mit dem kritischen Gedenken an und in der Fortsetzung des Denkens von Pier Paolo Pasolini setzt er ein.
Nie hatte Sciascia so klar vor Augen, welch todbringendes Instrument die Sprache ist. Was ihm das Sezieren der Briefe Moros aus seinen 55 Tagen im „Volksgefängnis“ abverlangt, ist noch heute in der Lektüre erfahrbar. Aufrüttelnd zeichnet er Moros Bewusstwerdungsprozess nach: Nur in der einst bewährten Sprache der Nichtkommunikation darf und muss dieser kommunizieren, wobei er jetzt um sein nacktes Leben kämpft. Umso flehentlicher, als er dann aus der Presse (die er dank „Kerkerethik“ zu lesen bekam) erfährt: Die „Freunde“ der DC-Riege haben ihn mit medial vereinten Kräften für verrückt erklärt, begründen so ihre höhnische Nicht-Verhandlungsstrategie, fällen sein Todesurteil. Nie war Moro gefährlicher: Nach dem von ihm vorangetriebenen historischen Kompromiss sollte sich Italiens Regierung als erstes europäisches Nato-Mitglied den Kommunisten öffnen, die eine breite Basis bei den italienischen Wählern hatten.
Zwei und zwei zusammenzählend ist Sciascias J’accuse durchdrungen von seiner auf Pirandello (auch Borges) bauenden Ironie. Die Abschweifungen in die süditalienische Esoterik und andere Grotesken – ein geniales Feuerwerk. Umso bitterer Sciascias Erkenntnis: Das Buch war längst geschrieben, als die Tragödie geschah. Der beigefügte „Bericht der Untersuchungskommission, vorgelegt von der parlamentarischen Minderheit“ (1982) konsolidiert die Wucht des Buchs. Abgefedert vom Nachwort Fabio Stassis „Der Leser als Detektiv“.
Gleichzeitig zum Erscheinen des Buches: 15. März + 16. März auf ARTE: „Und draußen die Nacht“ (Esterno notte) von Marco Bellocchio, Sechsteiler über die Entführung und Ermordung Aldo Moros
https://www.arte.tv/de/videos/RC-023478/und-draussen-die-nacht/
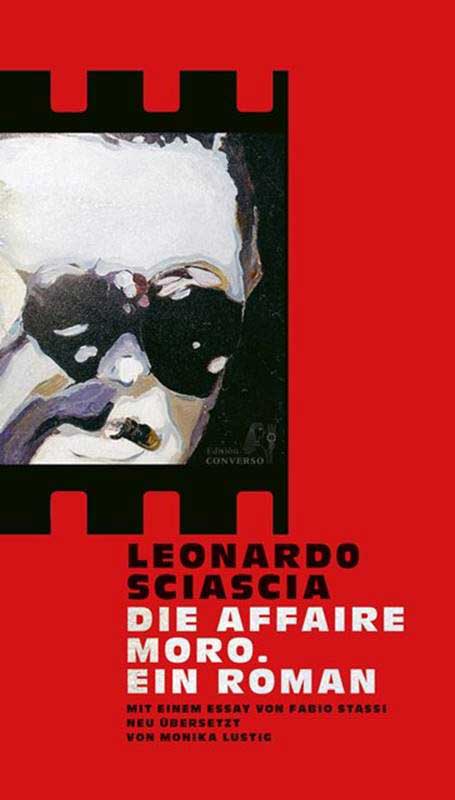
Leonardo Sciascia
Die Affaire Moro. Ein Roman
Mit einem Essay von Fabio Stassi
Neu aus dem Italienischen übersetzt von Monika Lustig
Seitenzahl:240 S.,
Preis: 24 € [D], 24,70 € [A] [A]
ISBN 978-3-949558-18-4
ET: ET: 15. Januar 2023
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]

100 Jahre nach dem Bevölkerungsaustausch:
Die Wurzeln lang ziehen. Eine pontische Spurensuche nach der Kleinasiatischen Katastrophe
„Der Begriff ‚Flüchtling‘ war in Griechenland ab den zwanziger Jahren, seit der Vertreibung, und über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg gleichbedeutend mit ‚Kleinasiate‘ bzw. ‚Pontosgrieche‘. Wenig von diesen Geschehnissen ist im europäischen Allgemeinwissen verankert.“ So schreibt die griechische Autorin und Lyrikerin Maria Topali in ihrem Memoir über die Geschichte ihrer Mutterfamilie, die aus der Pontos-Region am Schwarzen Meer stammt: Eine tastende, Lücken umkreisende Spurensuche rund um die sogenannte „Kleinasiatische Katastrophe“, die in bildmächtiger Sprache Makro- und Mikrogeschichte verbindet und, dem Faden der weiblichen Genealogie folgend, gegen das Schweigen ankämpft. Das Memoir ergänzen 28 Gedichte; ein Nachwort von Mirko Heinemann bietet eine tragfeste historische Einordnung und einen Einblick in aktuelle Debatten.
Offizielle Besiegelung der Katastrophe, die auch Topalis Familie mitriss, war nach dem Brand und dem Massaker von Smyrna die 1923 in Lausanne geschlossene griechisch-türkische Vereinbarung über den Bevölkerungsaustausch, der einzig nach dem Kriterium der Religionszugehörigkeit verlief. Das kollektive Trauma ist nach wie vor virulent: Topali sucht nach dem Aufscheinen der Vergangenheit im Alltag, beginnt nachzufragen. Schreiben heißt für sie, den unwirtlichen Ort jenes Schweigens zu verlassen, das etwa eine auf der Flucht umgekommene Großtante vor ihr verborgen hat – genauso wie die Erfahrungen ihres Großvaters im Zwangsbataillon. Topali fragt aber auch nach dem Davor und dem Danach der Katastrophe: „Wer waren die Menschen, die dich in die Welt gesetzt haben? Wer waren sie vorher? Was ist danach aus ihnen geworden?“ Der griechische Begriff „An den Wurzeln ziehen“, was „entwurzeln“ bedeutet, wird also um eine pontische Nuance – „etwas fortsetzen“ – ergänzt.
Maria Topali, die Lyrikerin, weiß um die Unzulänglichkeit des Erzählens: Es gibt Dinge, die nicht geradlinig sein können, so wie die Geschichte immer ambivalent ist: „Zum Glück haben die Dinge nie nur eine Seite.“ Dies betrifft das Leben der Frauen, die das harte Leben im Gebirge hinter sich lassen, genauso wie beide Täterseiten. Daher ergänzen Gedichte den Essay: Manche Räume vermag nur die Assoziationskraft der Lyrik angemessen zu füllen. Letztlich geht es Topali um ein Miteinander, wie es über Jahrtausende gelebt wurde (so entstand etwa auch der Name Istanbul, wie Mirko Heinemann in seinem Nachwort schreibt, aus der griechischen Redewendung Eis tin Poli – „in der Stadt“).
Maria Topali, Lyrikerin, geb. in Thessaloniki, wuchs mit Pontisch und Griechisch auf. Jurastudium in Athen und Frankfurt a. M., Veröffentlichung zahlreicher Gedichtsammlungen, Musiktheater-Libretti, Herausgabe der Anthologie Griechischer Lyrik des 21 Jh; Übersetzung v. Rilkes Duineser Elegien. Tätig am Nationalen Zentrum für Sozialforschung in Athen.
Mirko Heinemann, griechische Mutter, deutscher Vater, ist freier Journalist für zahlreiche Tages- und Wochenzeitungen, Magazine, Hörfunk. 2019 das erzählerische Sachbuch Die letzten Byzantiner über die Vertreibung der Pontosgriechen.
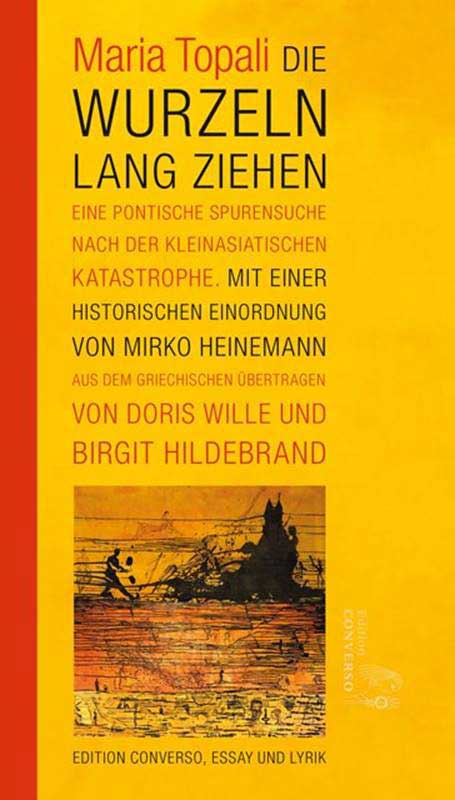
Maria Topali
Die Wurzeln lang ziehen. Eine Spurensuche nach der Kleinasiatischen Katastrophe
Essay und Lyrik
Mit einer historischen Einordnung von Mirko Heinemann
Aus dem Griechischen übertragen von Doris Wille und Birgit Hildebrand
Seitenzahl: 208 S.,
Preis: 24 € [D], 24,70 € [A] [A]
ISBN 978-3-949558-11-5
ET: ET: 28. Februar 2023
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]

Polit-Fiction aus Frankreich:
Antoine Volodines Einige Einzelheiten über die Seele der Fälscher
Im Zentrum von Antoine Volodines vielschichtigem Roman (aus dem Französischen v. Holger Fock) stehen das ehemalige RAF-Mitglied Ingrid und ihr Jäger Kurt aus dem BKA, der sich anhand ihres Fahndungsfotos unsterblich in sie verliebt hat. Dennoch oder gerade deswegen verhilft er ihr zur Flucht. In den letzten gemeinsamen Tagen in Lissabon steht zwischen ihnen Ingrids titelgebender Schlüsselroman über den Untergrundkampf, den sie im fernen Exil schreiben will. Mit großer poetischer Kraft und unbezähmbarer Phantasie entwirft Antoine Volodine ein Requiem auf die Nachkriegswelt, spielt dazu auf raffinierte Weise mit den Erzählebenen, nimmt die gängigen Totalitarismen auseinander, verpasst seiner Frustration über das zwangsläufige Scheitern aller Revolutionen einen teils schmerzlichen, teils erschreckend humorvollen Ausdruck. Literarische Polit-Fiction mit Sogwirkung.
Ingrids Roman im Roman spielt in einer Gesellschaft namens Renaissance, die hinter einer sozialdemokratischen Fassade von einer geheimnisvollen Macht beherrscht wird: Sie agiert im Verborgenen und kontrolliert die von kollektivem Gedächtnisverlust befallene Gesellschaft, deren Individuen keinerlei Erinnerung an ihre Kindheit haben. Wissenschaftler und Intellektuelle forschen in Kollektiven nach ihrer Herkunft und Geschichte. Ihr Schrifttum, niedergelegt in Archiven, bildet die dritte Handlungsebene des Romans. Ingrid verschlüsselt ihre Erfahrungen und erweist sich als die stärkere Akteurin, da leidensfähiger, kampferprobter: Niemand wird ahnen, dass ich eine wahre Geschichte unserer Epoche geschrieben habe.
Durch Volodines literarische Strategie der Unsicherheit können wir nie ganz sicher sein, wo wir uns befinden. Eins ist jedoch überall spürbar: Hier wirkt eine untergründige Erschütterung, die immer wieder offen als das aufbricht, was sie ist: die Folge von Gewalterfahrungen, die über die Jahrzehnte weitere Gewalt nach sich ziehen, und die Trauer um eine verlorene, vielleicht nie als solche existente Utopie.
Mit einem informativen Nachwort des Übersetzers Holger Fock: „Die Welt ist nicht aus Porzellan gemacht“.
Antoine Volodine, geb. 1950, vielfach ausgezeichneter Autor und Erfinder des Post-Exotismus. Übersetzungen in mehr als zehn Sprachen. Auf Deutsch bereits Alto Solo (1992), Dondog (2005), Mevlidos Träume (2011).
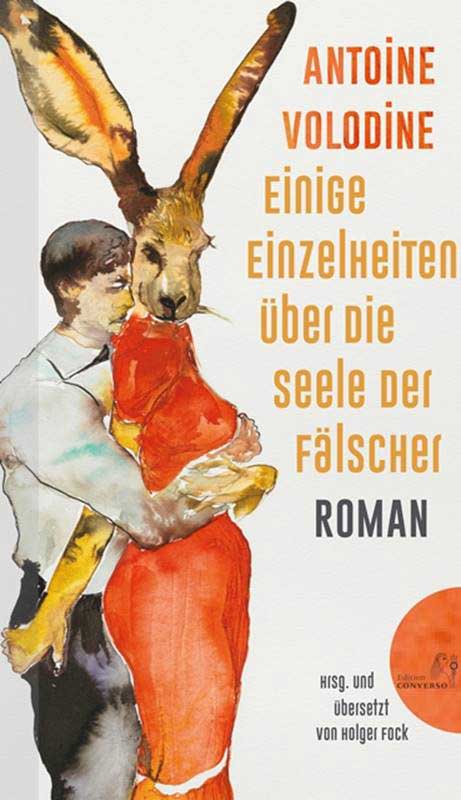
Antoine Volodine
Einige Einzelheiten über die Seele der Fälscher
Aus dem Französischen von Holger Fock
Mit einem Nachwort von Holger Fock
Seitenzahl: 320 S.,
Preis: 25 € [D], 25,70 € [A] [A]
ISBN 978-3-949558-14-6
ET: 18. Januar 2023
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]

„Papierschiffchen in der Wüste“
vom Schicksal der Jesiden und der Kraft des Geschichtenerzählens
„Die Zeichen, die der Stift auf die Seiten gesetzt … stammen aus der hohlen Hand einer aus Leibeskräften schreienden Frau“, so der Beginn von „Papierschiffchen in der Wüste“ der türkischen Autorin Ayşegül Çelik, einem „Roman in Erzählungen“, der sich den Jesidinnen und Jesiden im Südosten der Türkei widmet und dabei Wirkliches mit Mythologie und Träumen vermengt, Realität in Märchen und wieder zurückverwandelt. Die dicht verwobenen Geschichten erzählen aus einem Grenzgebiet, wo Menschen unterschiedlicher Religionen, Ethnien und Sprachen leben. Und sie machen Mädchen und Frauen zu ihren Protagonistinnen: Frauen, die sich auf ihre je eigene Weise selbst ermächtigen.
Den Anfang macht Afsun, die Geschichtenerzählerin: Schon ihre Mutter hat immerzu auf Zettel gekritzelt, ist jedoch darüber wahnsinnig geworden, dass ihre ältere Tochter, Afsuns Schwester, als Kinderbraut auf der anderen Seite der Grenze verschwand. Diese Schwester taucht nun in Afsuns erster Erzählung auf und webt um ihr Leben. In den folgenden Geschichten wechseln die Perspektiven, uns bereits bekannte Figuren ergreifen das Wort und geben es wieder weiter. Da fliegen Pfaue aus Teppichen auf und davon, ein Sprachklempner erschafft trennende, aber auch verbindende Wörter, wir erfahren von Versklavung der Frauen und weiblicher Widerstandskraft, von Beduinen, Dorfbewohnern und Schmugglern, von Blutrache und einem Zauberwald, der denjenigen, Männern wie Frauen, die ein anderes Leben wünschen, eine gemeinsame Zukunft ermöglicht. Die Unterdrückten und Vertriebenen erhalten hier eine Stimme, werden in ihr Recht versetzt und zeichnen selbst eine lebenswerte Utopie. Ein hochpoetisches Buch über die Bedeutung des Geschichtenerzählens und die Rettung durch die Fantasie, ein Plädoyer für ein selbstbestimmtes Leben, das auch uns in mancherlei Hinsicht den Weg aus der Wüste zu weisen vermag. Mit einem informativen Nachwort der Übersetzerin Sabine Adatepe.
Ayşegül Çelik ist Autorin mehrerer Erzählbände, Lyrikerin und Essayistin. Sie arbeitet für Film, TV und Radio und schreibt Opernlibretti. An der Universität Ankara lehrte sie Mythologie und Weltliteratur. Sie lebt auf der Halbinsel Datça, wo Mittelmeer und Ägais zusammenfließen. 2008 Literaturförderpreis Notre Dame de Sion. 2010 Yunus-Nadi-Erzählpreis.
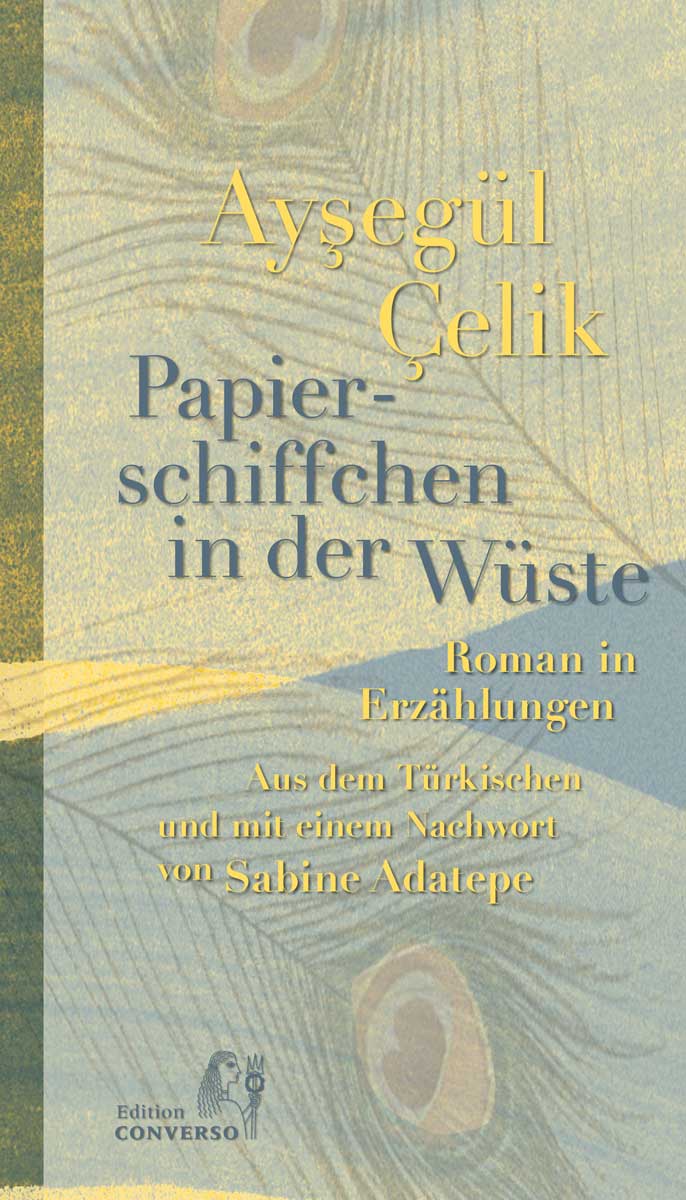
Ayşegül Çelik
Papierschiffchen in der Wüste
Aus dem Türkischen und mit einem Nachwort von Sabine Adatepe
Seitenzahl: 144 S.,
Preis: 22,00 € [D], 22,70 € [A]
ISBN 978-3-9822252-9-6
ET: 2. August 2022
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Wenn Literatur die Realität kapert:
Ich töte wen ich will von Fabio Stassi
Ein Krimi um den römischen Bibliotherapeuten Vince Corso
Vince Corso hat einen ungewöhnlichen Beruf: Er ist Bibliotherapeut, leistet Lebenshilfe durch Buchempfehlungen. Eines Tages findet er seine kleine Behausung in der römischen Via Merulana verwüstet vor, Bücher und Platten sind verstreut und zerstört, sein Hund vergiftet. Gibt es eine Verbindung zur Mordserie, die Rom erschüttert, Untaten, die immer dann geschehen, wenn Vince in der Nähe ist? Und was hat es mit dem seltsamen Blinden auf sich, der ihm ständig über den Weg läuft? Unfreiwillig wird Vince zum Ermittler und steht bald selbst unter Verdacht, während vor seinen Augen Fiktion und Realität verschwimmen.
In Ich töte wen ich will, erster Band einer Krimireihe um Vince Corso, treibt Fabio Stassi ein raffiniertes Spiel: Da kullern Köpfe unter Straßenbahnen hervor, wird reichen Damen in der Via Merulana die Kehle aufgeschlitzt, ein Häftling namens Queequeg schreibt an Vince aus der Haftanstalt Regina Coeli, französische Chansons geleiten uns durch die Kapitel und der melancholische Vince selbst ist ein Suchender, schreibt regelmäßig Briefe an den Vater, den er nie kennengelernt hat. Ein vielschichtiges Buch, das Höchstspannung mit dem Vergnügen der literarischen Spurensuche verbindet und die Leser durch seine dichte Atmosphäre in den Bann zieht. Und nicht zuletzt ein Buch für alle, die einem Rom jenseits der Klischees verfallen sind – auch eine Liste von Vince Corsos Spaziergängen durch die Stadt ist zu finden.
Fabio Stassi, geb. in Rom in einer Familie von Weltenwanderern, stellt das Thema der mehrfachen Identität in den Mittelpunkt seiner literarischen Suche. Seine Vorbilder sind Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo. Mit der fiktiven Biografie von Charlie Chaplin L’Ultimo Ballo di Charlot, deutsch Ein Pakt fürs Leben, übersetzt in 19 Sprachen, schaffte er den internationalen Durchbruch.

Fabio Stassi
Ich töte wen ich will
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Seitenzahl: 304 S.,
Preis: 22 € [D], 22,70 € [A]
ISBN 978-3-9822252-8-9
ET: 24. Februar 2022
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Zwei Neuerscheinungen zu Pier Paolo Pasolinis 100. Geburtstag am 5. März 2022
Am 5. März 2022 wäre Pier Paolo Pasolini hundert Jahre alt geworden: Im Andenken erscheinen in der Edition Converso zwei Bücher, die neue Perspektiven auf den großen italienischen Intellektuellen eröffnen und zeigen, wie lebendig, facettenreich und auch unbequem sein Werk heute noch ist.
„Der Torschützenkönig ist unter die Dichter gegangen“ von Valerio Curcio – samt einem Vorwort von Moritz Rinke und einem Interview mit Dacia Maraini – nimmt Pasolinis Fußball-Leidenschaft in den Blick: Da sind seine Liebe zum FC Bologna; seine eigenen Erfahrungen als Spieler – auf kleinen Plätzen der römischen Vorstadt wie in großen Stadien mit der Nationalmannschaft aus darstellenden Künstlern; die Spuren, die der Fußball in seinem Werk hinterlassen hat; seine Arbeit als Sportreporter; und seine originellen Beiträge zur Rolle des Fußballs als letztem religiösen Ritus der zeitgenössischen Gesellschaft. Im Fußball schöpft Pasolini Kraft und Inspiration – und er versteht ihn als universelle Sprache, als Mittel des Austauschs und der sozialen Teilhabe.
Im Juni 1942 verfasst der 20-jährige Pasolini den Bericht „Italienische Kultur und europäische Kultur in Weimar“, in dem er sich mit verblüffenden Einschätzungen zur Teilnahme an der „Kulturkundgebung der Europäischen Jugend Weimar – Florenz (18.–23. Juni 1942)“, veranstaltet von der Reichsjugendführung, bekennt. Bricht Pasolini ahnungslos ins Nazideutschland auf? Genügt ihm der Glaube an einen natürlichen Antagonismus zwischen Politik und Kultur? Ausgehend von diesem Text – der vielerlei Umdeutungen erfahren hat und hier erstmals in Übersetzung vorliegt – beschreibt „Eine Jugend im Faschismus“ (mit Beiträgen von Florian Baranyi und Monika Lustig) ein biografisches, historisches und kulturelles Spannungsfeld und hinterfragt die Mechanismen hinter der Entstehung des „Mythos Pasolini“.
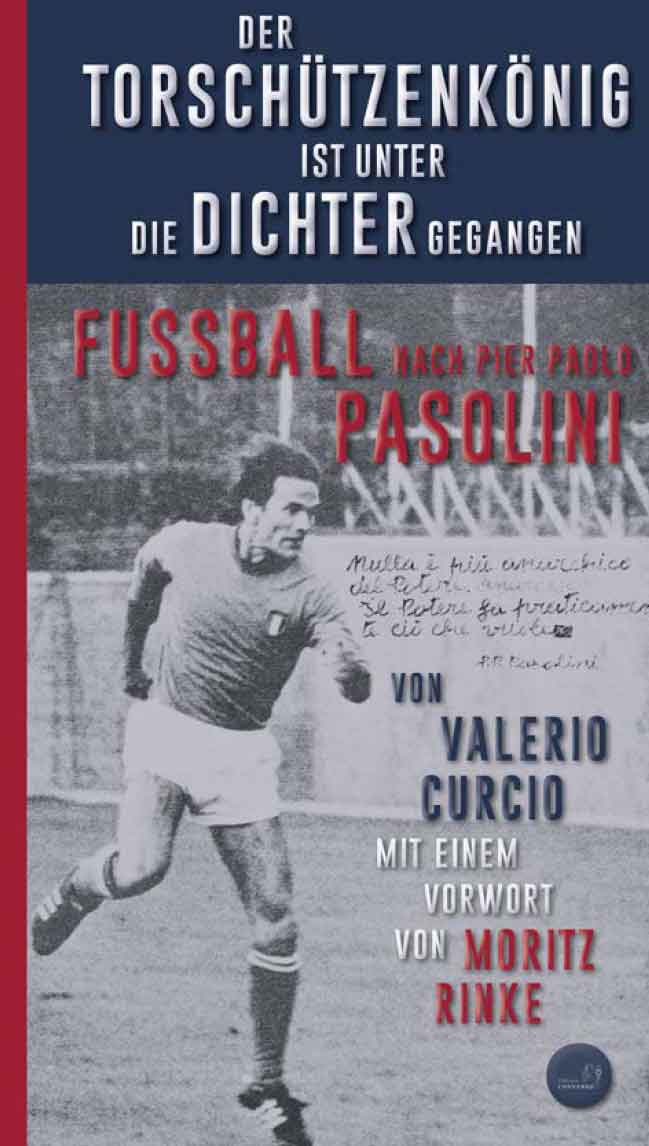
Valerio Curcio
Der Torschützenkönig ist unter die Dichter gegangen – Fußball nach Pier Paolo Pasolini
Mit einem Vorwort von Moritz Rinke
Aus dem Italienischen von Judith Krieg
Mit zahlreichen Abbildungen
Seitenzahl: 190 S.,
Preis: 20,00 € [D], € 20,70 [A]
ISBN 978-3-9822252-6-5
druckgerechtes Cover herunterladen
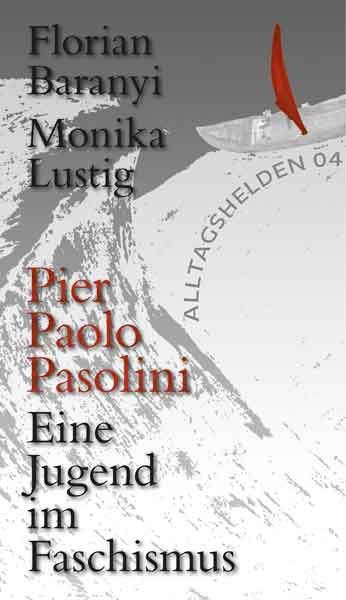
Florian Baranyi, Monika Lustig:
Pier Paolo Pasolini. Eine Jugend im Faschismus
Mit dem Originaltext „Italienische Kultur und europäische Kultur in Weimar“
Seitenzahl: 128 S.,
Preis:18,00 € [D], € 18,50 [A]
ISBN: 978-3-9822252-7-2
ET: Anfang April 2022
druckgerechtes Cover herunterladen
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
Die Nadeln des Aufstands: eine politisch-rebellische Kulturgeschichte des Strickens
In ihrer kenntnisreichen Kultur- und Sozialgeschichte des Strickens (und Häkelns) wendet sich die griechische Autorin Katerina Schiná mit immer aufs Neue aufblitzendem Humor unterschiedlichsten Facetten ihres Gegenstands zu: Betrachtet werden etwa die rebellischen Seiten des Handwerks anhand von Frauengestalten der Mythologie, den tricoteuses der Französischen Revolution oder den Aktivistinnen der Gegenwart, der kontemplative Charakter des Strickens als Selbstfindung, die Überwindung von Rollenklischees durch strickende Männer wie Präsident Roosevelt oder die Verflechtung des Strickens mit der Musik, der Lyrik, der Mathematik und der Ökologie.
Als Katerina Schiná in den siebziger Jahren ihre Leidenschaft fürs Stricken entdeckte, rümpften die griechischen Feministinnen die Nase. Schiná hielt unbeirrt am Strickzeug fest, entdeckte im Handwerk einen Kern der Selbstermächtigung („Mein Pullover bin ich“), stieß auf Anna Zilboorgs Knitting for Anarchists. Dieser individuelle Ansatz bildet den Auftakt ihres Buches. In der Folge betrachtet sie den kontemplativen Charakter des Strickens als Prozess der Selbstfindung und spinnt einen historisch-politischen Bogen von den Frauengestalten der Mythologie bis hin zu politischen Künstlerinnen aus aller Welt, etwa zum Pink Tank von Marianne Jørgensen: Strickdeckchen aus der ganzen Welt, über den Militärpanzer geworfen, machen diesen manövrierunfähig; oder zu griechischen Künstlerkollektiven, deren Strickmustern die Daten des Arbeitsamtes zugrunde liegen. Weitere Kapitel zeigen überraschende Verbindungen zu Musik, Mathematik und Ökologie: So dient das Häkeln etwa der Visualisierung mathematischer Formeln oder dem Protest gegen das Korallensterben. Mit Klischees über ein vermeintlich weibliches Handwerk bricht Schiná im Kapitel Eine männliche Kunstfertigkeit, in Ein warmer Pullover gegen den Kalten Krieg schildert sie die Rolle des Strickens in Kriegszeiten und in der Friedensbewegung.
Zahlreiche Abbildungen und eine Auswahl themenspezifischer Gedichte, teils in Neuübersetzung, runden den Band ab.
Katerina Schiná (Jg. 1956) ist Autorin, Literaturkritikerin und Übersetzerin (u. a. Toni Morrison, Philip Roth, J. C. Oates). Die Nadeln des Aufstands wurde 2015 mit dem griechischen Staatspreis für Essay und Sachbuch ausgezeichnet.
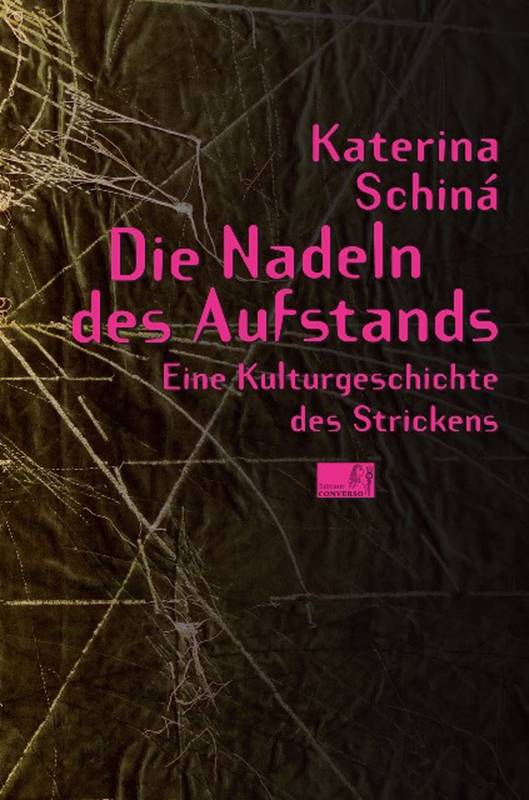
Katerina Schiná
Die Nadeln des Aufstands. Eine Kulturgeschichte des Strickens
A d. Griechischen übersetzt und hrsg. v. Doris Wille Gedichtübertragungen aus d. E. von Alissa Walser
Mit zahlreichen Abbildungen
Seitenzahl: 216 S.,
Preis: 28 € [D], 28,70 € [A]
ISBN 978-3-9822252-5-8
ET: 1. Aufl. Okt. 2021 / 4. Aufl. April 2022
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Maria Attanasio: Stark wie nur eine Frau
Ein sizilianischer Beitrag zur Identitätsdebatte, ein Schreiben wider das Vergessen
Sizilien, Caltagirone, an der Schwelle vom 17. zum 18. Jahrhundert. Die Bevölkerung ist gebeutelt von Hungersnöten, Erdbeben, den Mächtigen, der Spanischen Inquisition. In diesem Szenario spielt Stark wie nur eine Frau mit seinen Erzählungen über zwei sehr unterschiedliche Frauen, denen Maria Attanasio in historischen Quellen begegnet ist: Da ist einerseits die schöne, analphabetische Bäuerin Francisca, andererseits die gebildete Adlige Ignazia. Beide widersetzen sie sich, unter Lebensgefahr, den Konventionen und Geschlechterrollen ihrer Zeit.
In Wir schrieben das Jahr 1698 und in der Stadt trug sich Denkwürdiges zu sieht Francisca sich nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes gezwungen, Männerkleidung anzulegen: Nur so kann sie auf dem Feld Seite an Seite mit den Tagelöhnern arbeiten. Sie wird denunziert und landet vor dem Inquisitor. Doch dieser, selbst eine unkonventionelle Figur, trifft eine überraschende Entscheidung … Ignazia in Der Glanz des Nichts wiederum will sich, fast noch ein Kind, das Singen nicht verbieten lassen; das Verbot treibt ihr widerständiges Wesen erst richtig hervor. Sie verweigert alle „weiblichen“ Betätigungen, widmet sich der asketischen Pflege ihres Geistes. Doch gerade der Schönheit dieses Geistes wird der deutsche Graf Trahun hoffnungslos verfallen.
Mit den Mitteln einer Poetin rettet Maria Attanasio diese Frauenfiguren vor dem Schweigen einer männlich geprägten „großen“ Geschichtsschreibung: Sie spricht von der „Genealogie der Mütter“, der sie mit ihrem Schreiben eine Form verleiht. Ihre Spurensuche zeigt uns Frauen, die darum kämpften, sie selbst sein zu können. Franciscas und Ignazias Denken und Handeln sind auch aus heutiger Sicht von frappierender Konsequenz. In ihrem Nachwort hinterfragt Monika Lustig die Fragment bleibenden Bilder vom Kosmos Sizilien, der in Namen wie Siculia immer schon weiblich war.
Für ihre Erzählungen wurde Maria Attanasio, die mit Sciascia, Camilleri und Piazzese zur „sizilianischen Schule“ zählt, mit dem Premio Piero Chiara 2020 ausgezeichnet.
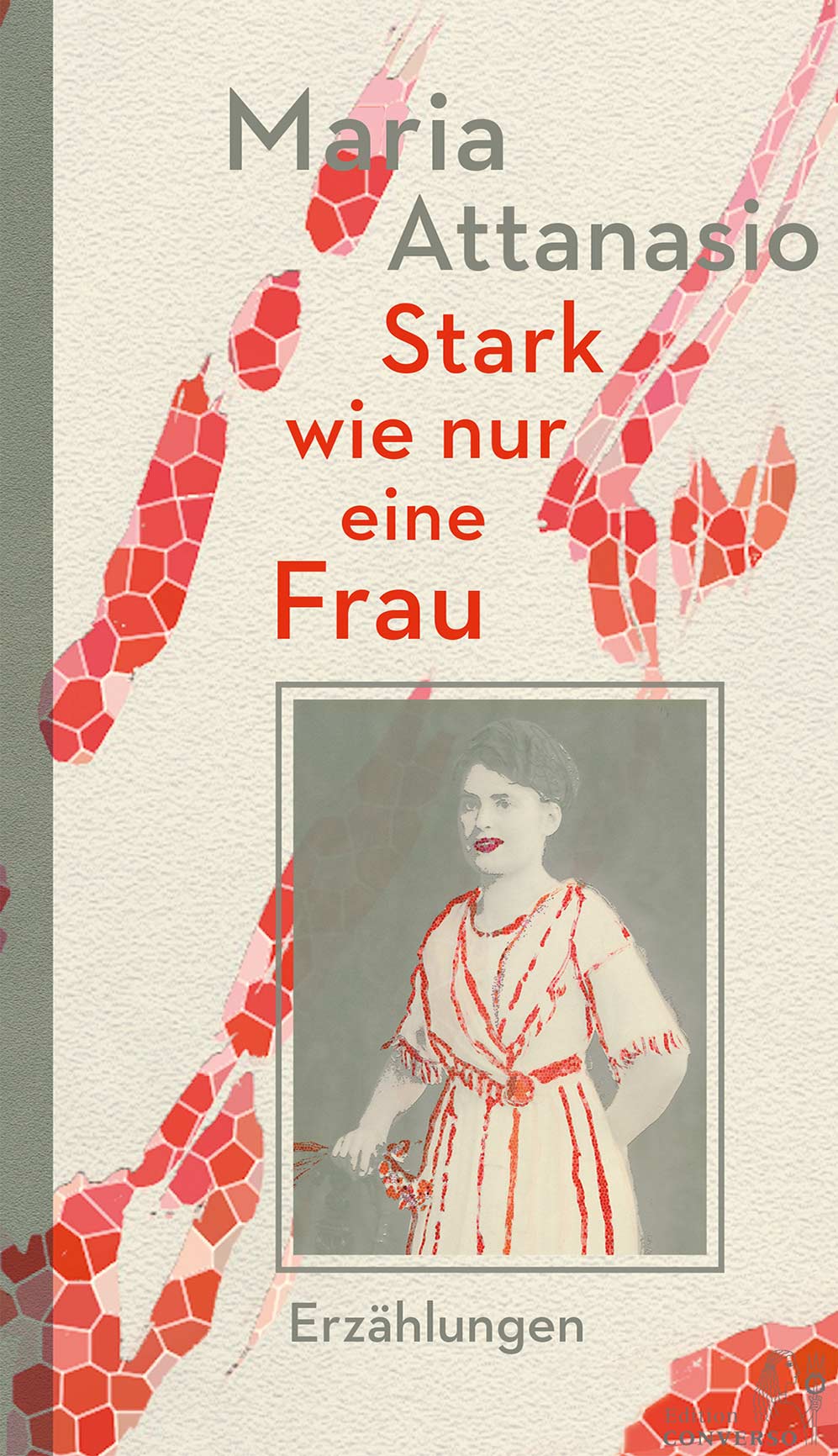
Maria Attanasio
Stark wie nur eine Frau
Erzählungen
Aus dem sizilianischen Italienisch von Judith Krieg und Monika Lustig
Mit einem Nachwort von Monika Lustig: Von der Überlegenheit des weiblichen Geschlechts
Seitenzahl: 156 S.,
Preis: 20 € [D], 20,60 € [A]
ISBN 978-3-9822252-2-7
ET: 15. September 2021
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Politischer True Crime aus Slowenien: Du existierst nicht von Miha Mazzini
Zala, eine junge slowenische Erzieherin, trifft im Krankenhaus zur Entbindung ein. Doch aufgenommen wird sie erst nach dramatischen Szenen, denn: Im Computerverzeichnis existiert sie nicht. Innerhalb kürzester Zeit nimmt die Realität kafkaeske Dimensionen an: Auf einmal ist Zala eine Fremde und ihr Kind frei zur Adoption. In Du existierst nicht erzählt Miha Mazzini eine packende und verstörende Geschichte mit realem Hintergrund: 1992 wurden 25.000 Einwohner Sloweniens, diejenigen mit dem „falschen“ Geburtsort, einfach aus den Registern gelöscht und fanden sich als illegale Einwanderer wieder. Das Buch liegt der preisgekrönten Doku-Fiction Erased (2018) zugrunde, bei der Mazzini Regie geführt hat.
Zala kämpft um ihr Kind und gegen Windmühlen: Zur Seite stehen ihr dabei Nikola, ein anderer „Ausgelöschter“, und der verheiratete Amerikaner Mark, ihre geheim gehaltene Liebe. Auch zu ihrem Vater, dem ehemals stolzen Militär und Kommunisten, den der Zerfall des jugoslawischen Reichs tief getroffen hat, nimmt sie wieder Kontakt auf. Mit seinen Figuren entwirft Mazzini ein Mosaik der Gesellschaft im damals noch jungen Staat Slowenien. Doch die Auslöschung ist ein grenzübergreifendes Phänomen, wie es der Amerikaner Mark im Roman auf den Punkt bringt: „Ich habe mich erkundigt, allein in Europa gibt es 300.000 Gelöschte, weltweit zehn Millionen. Ich hätte nie gedacht, dass Regierungen das so gerne machen. Die Öffentlichkeit protestiert nicht. Solange sie nicht selbst betroffen sind, interessiert es nicht, und wenn doch, dann ist es zu spät.“
„Lassen Sie es mich klipp und klar sagen: Die Gründe für die Auslöschung waren zutiefst rassistisch.“ Miha Mazzini in seinem Nachwort zu Du existierst nicht
Die Werke des slowenischen Schriftstellers, Drehbuchautors und Regisseurs Miha Mazzini wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter ins Englische, Französische, Italienische und Türkische. Bis heute wurden ihm knapp dreißig Auszeichnungen für seine literarisches und filmisches Werk verliehen.
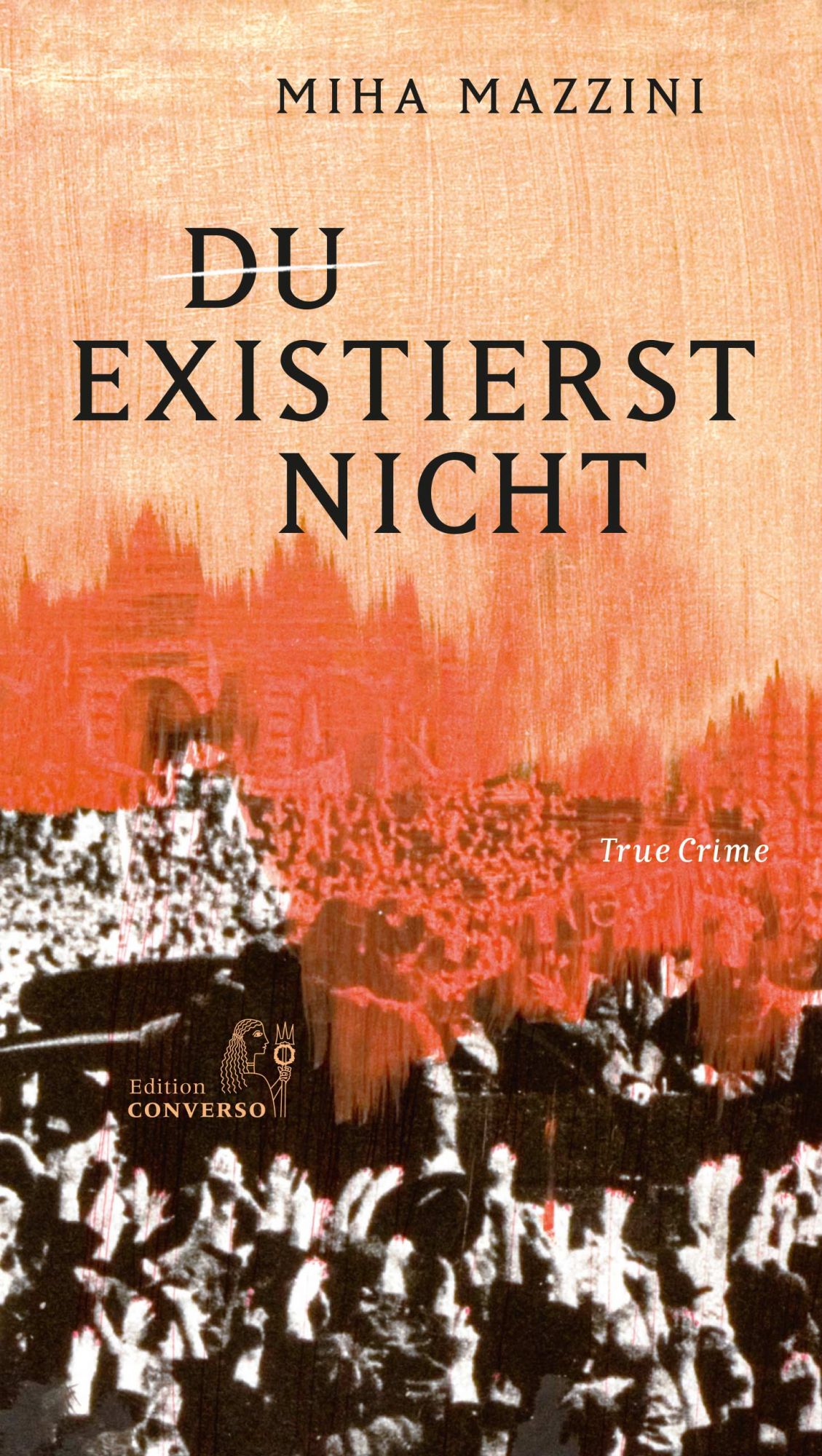
Miha Mazzini
Du existierst nicht
Aus dem Slowenischen von Ann Catrin Bolton Mit einem Nachwort von Miha Mazzini
Seitenzahl: 316 S.,
Preis: 23 € [D], 23,70 € [A]
ISBN 978-3-9822252-3-4
ET: 15. September 2021
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Die lustlosen Touristen von Katixa Agirre
Eine Reise durchs Baskenland: Die lustlosen Touristen von Katixa Agirre
„Nehmen wir an, du möchtest – und jetzt aber richtig! – mein Land kennenlernen, meine Wiege, den Ursprung von all dem. (…) Meinen Ruin, um es mal klar zu sagen. Aber das weißt du noch nicht. Du wirst es schon noch rausfinden. Zu gegebener Zeit. Das macht die Reise ja letzten Endes aus, Selbsterkenntnis mit allem Drum und Dran.“ So beginnt die Baskin Ulia einen Liebesbrief an ihren Mann Gustavo, einen Brief, der gleichzeitig eine durchs Baskenland führende Road Novel ist. Eine Reiseerzählung mit vielen überraschenden Wendungen, die in beschwingt-sarkastischem Ton Verletzungen und Leerstellen umkreist, Themen wie Terror, Herkunft, Zugehörigkeit, Engagement, die Bedingungen eines Scheiterns oder Gelingens der Liebe behandelt und dabei nie ihre Leichtfüßigkeit verliert.
Ulia ist gescheiterte Mezzosopranistin, nun Doktorandin in Musikwissenschaften, Gustavo ein erfolgreicher Jurist und Genussmensch. Kennengelernt haben sie sich in der Metro, am Tag der Terroranschläge in Madrid. Sie verlieben sich, heiraten bald, kein Blatt scheint zwischen sie zu passen. Doch auf der Reise in Ulias Heimat zeigt sich, dass jeder der beiden etwas zu gestehen hat. Kunstvoll verwebt Katixa Agirre verschiedene Ebenen: Da sind das Paar Ulia und Gustavo, ihre Liebe zur Musik und zum Essen, die Geschichte von Ulias Mutter und Vater, von dem sie dachte, er wäre vor ihrer Geburt gestorben, der jedoch seit Jahrzehnten als verurteilter ETA-Aktivist im Gefängnis sitzt. Ulia promoviert zudem über den Komponisten Benjamin Britten – Szenen aus dessen Leben werden eingeflochten, sein Pazifismus wirft zusätzliche Fragen nach Positionierung und persönlicher Verstrickung auf. Ein Roman, der das Komponieren nicht nur inhaltlich und metaphorisch aufgreift, sondern auch handwerkliche Parallelen aufweist, mit Motiven, Variationen arbeitet, bis hin zum „Duett“ des Liebespaars, dem gegenseitigen Geständnis gegen Ende. Eine Autorin mit unverwechselbarem Ton und präzisem Blick, eine Reise mit nachklingendem Soundtrack.
Katixa Agirre bekennt sich, obwohl „kleine Sprache“ und „Minderheitenliteratur“, zum Schreiben auf Baskisch. Ihre Werke wurden bereits in 10 Sprachen übersetzt, Die lustlosen Touristen (Original: Atertu Arte Itxaron) hat sie selbst ins Spanische übertragen. Der Roman wurde 2015 mit dem Premio 111 Akademia ausgezeichnet. Silke Kleemann erhielt für ihre Übersetzung ins Deutsche das Übersetzerstipendium des Freistaats Bayern 2020.
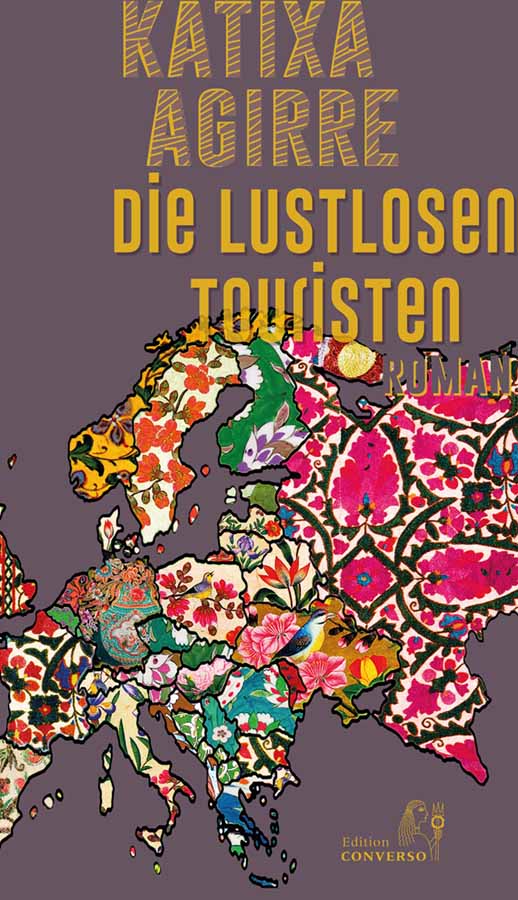
Katixa Agirre
Die lustlosen Touristen
Aus dem Spanischen von Silke Kleemann
240 S., 20 € [D], 20,60 € [A]
ISBN 978-3-9822252-1-0
ET:11. März 2021
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Chaza Charafeddine: Beirut für wilde Mädchen
„Als ich klein war, wünschte ich mir, ein Junge zu sein. Als Jugendliche wollte ich mich dem bewaffneten Kampf anschließen; später wünschte ich mir nur noch einen Ort, an dem ich bleiben kann. Nichts von alledem ist Wirklichkeit geworden. Dennoch, manches wollte ich nie anders haben: meine Familie, meine Sprache und mein verfluchtes Land.“ So schreibt die libanesische Autorin Chaza Charafeddine in Beirut für wilde Mädchen: eine literarische Autobiographie, in der sie aus Sicht eines Kindes, später einer Jugendlichen ihr Aufwachsen im kulturellen und religiösen Schmelztiegel Libanon schildert, mit allen Umbrüchen und Radikalisierungen seit den 70er- und 80er-Jahren. Mit 18 geht sie in die Schweiz und nach Deutschland: Heimat wird ihr nun die Sprache. In seinem Nachwort erläutert Stefan Weidner die literarischen Zusammenhänge und historisch-politischen Hintergründe, von der Gründung des Libanon bis zur Explosion im Beiruter Hafen 2020.
Die Erzählerin besticht durch ihren ironisch-unangepassten Blick auf die vielen, auch tragisch-irrsinnigen Widersprüche des politischen und familiären Lebens: Ihr Freiheitshunger nimmt seinen Anfang in einer katholischen „Christenschule“ in Beirut, wohin die Eltern, eine schiitische Familie, sie und ihre Geschwister schicken, gemäß ihrem Bedürfnis, Teil der Moderne zu sein. Doch der Ausbruch des Bürgerkriegs treibt die Familie in den Rückzug: Sie suchen Zuflucht in ihrer Identität als Schiiten. Die Tochter politisiert sich und bewahrt gleichzeitig einen unbestechlichen Individualismus. Grund für ihre Auswanderung ist ebenfalls der Wunsch einer „Nur-als Mädchen-Geborenen“, allen beengenden Traditionen zu entfliehen. Ihr kritischer Blick verbindet weiterhin Kulturen und treibt dabei die Brüche ihrer traumatisierten Wahlheimat hervor.
Chaza Charafeddine ist 1964 in Tyros im südlichen Libanon geboren und in Beirut aufgewachsen. Sie hat Pädagogik und Tanz studiert, bevor sie zur Kunst und zum Schreiben fand; obwohl sie sich in vier Sprachen bewegt, verlässt sie sich beim Schreiben nur auf ihre erste Sprache, das Arabische. Mit ihrer Kunst bezieht sie stets Position und ist in Galerien weltweit vertreten. Ihre Texte sind in Anthologien und Magazinen erschienen. Heute lebt Chaza Charafeddine in Deutschland und im Libanon.
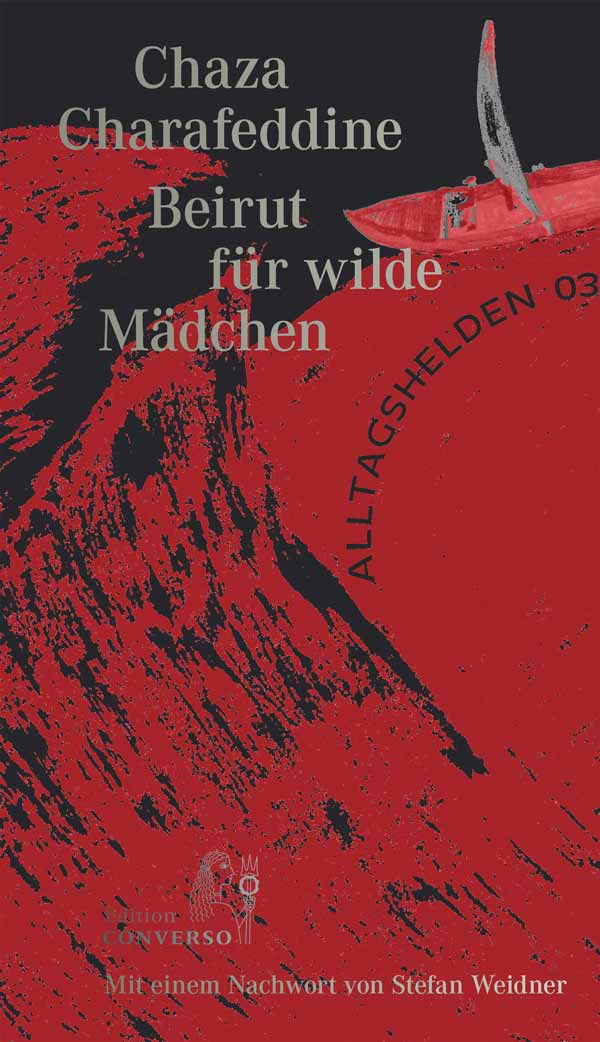
Chaza Charafeddine
Beirut für wilde Mädchen
Autobiographischer Roman in zwei Teilen
Aus dem Arabischen von Günther Orth
Mit einem Nachwort von Stefan Weidner
160 S., 18 € [D], 18,60 € [A]
ISBN 978-3-9822252-0-3
ET: 8. Januar 2020
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Zu Leonardo Sciascias 100. Geburtstag am 8. Januar 2021
Neuerscheinung „Ein Sizilianer von festen Prinzipien“ präsentiert essayistische Erzählungen in Erstübersetzung
Am 8. Januar 2021 wäre Leonardo Sciascia hundert Jahre alt geworden. Unsere Gegenwart hätte reichlich Stoff bereitgehalten für den sizilianisch-europäischen Intellektuellen mit dem aufklärerisch-politischen Antrieb und dem untrüglichen Blick für gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Wir können uns weiter an sein Werk halten und von ihm lernen, unter die Oberfläche zu schauen, uns von der Vernunft leiten zu lassen.
Leonardo Sciascia wurde zunächst mit Kriminalromanen wie Der Tag der Eule und Todo modo oder das Spiel mit der Macht bekannt, in denen er die Verbindungen zwischen Politik und organisierter Kriminalität freilegte. Doch die Engführung des Blicks auf diese Bücher – so innovativ sie als Demontage des Kriminalgenres auch waren – wird dem Autor nicht gerecht: Zu den größten Höhen schwang er sich mit seinen literarisch-historisch-soziologischen Essays und Romanen auf, mit seinen Rekonstruktionen und Fallbeschreibungen in Nachfolge Manzonis. Jahrzehntelang war er eine der prägenden intellektuellen Figuren Italiens, schrieb in allen Genres. So entstand etwa „Die Affäre Moro“, ein Pamphlet, in dem er darlegte, wie die Christdemokraten ihren Vorsitzenden im Stich gelassen hatten. Als pointierter, teils provokanter Kommentator in den großen italienischen Zeitungen war er bekannt und gefürchtet, auch in Frankreich und Spanien, wo er regelmäßig publizierte.
Als Hommage an den Mann mit dem unabhängigen Geist und der spitzen Feder erscheint am 8. Januar 2021 ein Ein Sizilianer von festen Prinzipien: ein Band mit zwei literarischen Fallbeschreibungen, Tod des Inquisitors und Der Mann mit der Sturmmaske. Die Beschreibung eines Falls aus der Zeit der Spanischen Inquisition in Sizilien lag Sciascia von all seinen Texten besonders am Herzen: Sie bildet einen Angelpunkt seines Werks, das sich stets um das Problem der Gerechtigkeit dreht. Im Zentrum des Essays steht der als Häretiker angeklagte Mönch Fra Diego La Matina, der seinem Folterer, dem Inquisitor, den Schädel einschlug und dafür auf dem Scheiterhaufen landete. Doch wieso wurde der Geistliche überhaupt verfolgt? Was warf ihm die Inquisition vor? Diese war damals die mächtigste aller Organisationen, stand über Verfassung, König und Papst und wurde gestützt von 1000 familiari, Delinquenten auch aus den obersten Gesellschaftsschichten.
Sciascia heftet sich auf die Spuren eines Menschen mit sozialem Gewissen und analysiert dabei das Unrechtssystem der Inquisition, die „weit davon entfernt ist, nicht mehr in der Welt zu existieren“. Entsprechend hält der Text ein Instrumentarium für die Nachwelt bereit: Wie erkennen wir Mechanismen der Macht, Gefahren, die aufkommen, wenn es keine regulierenden Instanzen gibt? Wie benennen wir die Fehler der Vergangenheit und erkennen sie in der Gegenwart wieder? Wie halten wir die Freiheit des Individuums hoch, wie die Wehrhaftigkeit der Demokratie? Diese Fragen sind nach Sciascia jedem von uns aufgegeben. Abgerundet wird der Band durch den biographischen Essay Klarheit, Vernunft und Häresie von Maike Albath und die Abhandlung Ironie – ein sizilianisches Instrument des Überlebens von Santo Piazzese.
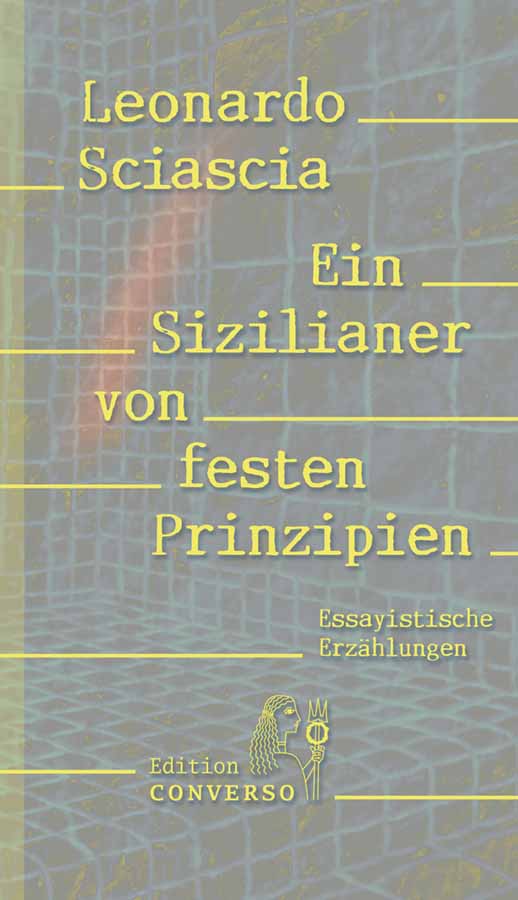
Leonardo Sciascia
Ein Sizilianer von festen Prinzipien
Essayistische Erzählungen.
Aus dem Italienischen von Monika Lustig unter Verwendung einer Übersetzung von Michael Kraus.
Mit einem Grußwort von Monika Lustig.
192 S., 23 € [D], 23,70 € [A] ISBN 978-3-9819763-9-7
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Maja Gal Štromar: Denk an mich, auch in guten Zeiten
Es gibt … nur eine Wahrheit, wir alle haben Väter. Und der können wir nicht entkommen. Diese Erkenntnis bildet den Unterstrom von Denk an mich, auch in guten Zeiten der slowenischen Autorin Maja Gal Štromar, ein „Brief an den Vater“ aus weiblicher Hand. In den fünf Tagen zwischen Tod und Beisetzung umkreist die Schreibende die Figur ihres verstorbenen Vaters: Sie formt eine bildmächtige Stimme, eine mal dahinbrausende, mal tastend-assoziative, jedoch immer hypnotische Erzählbewegung, um den ins Netz zu bekommen, der sich zu Lebzeiten stets entzog und nun sogar mit seinem Versprechen einer Unendlichkeit gebrochen hat.
Wer war er, der großzügige „König“, der es nach außen hin allen rechtmachte, für alles und jeden Verantwortung übernahm, sich hinter den Kulissen, der eigenen Familie gegenüber aber schweigsam zurückzog oder trunken wütete? Der „Herzenswaise“, der nichts lieber sein wollte als ein Sohn? Sein eigener Vater, ein Widerstandskämpfer, wurde kurz nach seiner Geburt ermordet, in der persönlichen Geschichte scheinen die blinden Flecken der mitteleuropäischen Historie auf. Und während die Erzählerin nach dem Vater tastet, erschafft sie sich selbst neu: Wie im Theater finden wir in ihrem selbstironischen Monolog die Rollen der Trauernden und Glücklichen, der Tochter, Schwester, Braut, Kontrahentin, Rivalin, folgsamen Pionierin in einer Person vereint. Am Ende ist ihr das scheinbar Unvereinbare gelungen: loszulassen und zugleich anzunehmen. Sie hat sich befreit, das Haus der Kindheit niedergebrannt, das Vermächtnis des Vaters ausgegraben, sich aufs Verzeihen zubewegt.
Maja Gal Štromar, geboren 1969 in Novo Mesto, lebt in Ljubljana. Sie ist eine echte Renaissancenatur: Schauspielerin, Theater- und Filmregisseurin, Dichterin, Romanschriftstellerin, Übersetzerin. Für den hier in Übersetzung vorgelegten Roman wurde sie von der Kritik gefeiert; ihr Roman Ženska drugje kam in die Auswahlliste für den Kresnik-Literaturpreis – Bester Roman des Jahres 2017.
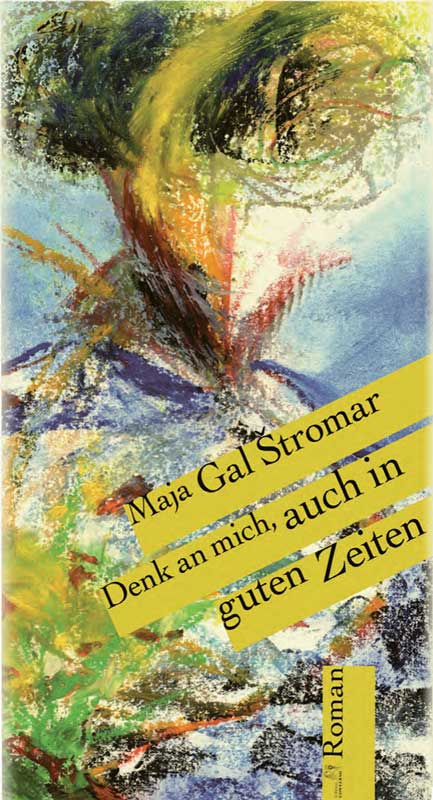
Maja Gal Štromar
Denk an mich, auch in guten Zeiten
Roman. Aus dem Slowenischen von Ann Catrin Bolton mit einem Nachwort von Slavo Šerc
208 S., 20 € [D], 20,60 € [A]
ISBN 978-3-9819763-8-0
ET: 18 September 2020
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Ausführliche Notizen über den kuriosen Fall des Paolo Ciulla aus Caltagirone
Paolo Ciulla, größter Geldfälscher der italienischen Geschichte, landet 1923 in Catania auf der Anklagebank: Er hat eine Flut von Blüten, schöner als das Original, auf den bedürftigen Teil der sizilianischen Bevölkerung niedergehen lassen. Wie konnte aus dem hochtalentierten Maler ein moderner Robin Hood werden, der schließlich im Armenhaus endet?
Die sizilianische Autorin Maria Attanasio heftet sich in ihrem Roman auf die Spuren eines überreichen Lebens, Kaleidoskop politischer und künstlerischer Utopien und historischer Umbrüche, das unserer Krisenzeit einen Spiegel vorhält: Vom Sizilien des 19. Jahrhunderts, geprägt vom Kampf um soziale Gerechtigkeit, zieht es Ciulla – den Maler, Pionier der Fotografie, Sozialisten – nach der Niederschlagung der Arbeiter- und Bauernbewegung ins Paris von Picasso und Modigliani, mit der Auswandererwelle nach Südamerika und wieder zurück nach Catania. Ein Roman über eine in jeder Hinsicht eigenwillige Figur, die in einer Zeit der Epidemien, der Bankenskandale, der großangelegten Fälschungen und gesellschaftlichen Erdrutsche ihre Kunst zu Hilfe nimmt, um den Menschen gerecht zu werden. Ein System zu untergraben, dessen Mechanismen auch heute bestens bekannt sind: „Die Welt ist eine des Betrugs, der Fälscher hält ihr nur den Spiegel vor.“ Und gleichzeitig ein Roman über Leidenschaften und die Unmöglichkeit einer Flucht vor sich selbst: Paolo Ciulla lebt seine Homosexualität generös aus und sucht sie doch zu verbergen.
So vielschichtig wie ihre Figur ist auch Maria Attanasios fabulierende Geschichtsschreibung im Geiste einer Ästhetik des Widerstands, die immer ein Anschreiben wider das Vergessen ist: wider die Auslöschung individueller Schicksale, wider die blinden Flecken der offiziellen Historie, wider die Launen des Zeitgeists. Hierbei geht es auch um einen anderen Blick auf Sizilien, das entgegen abgeschmackter Urteile ein Land der kämpferischen Vordenker ist. Für den Roman über Paolo Ciulla erhielt die vielfach preisgekrönte Dichterin, Romancière und Essayistin den Superpremio Elio Vittorini.
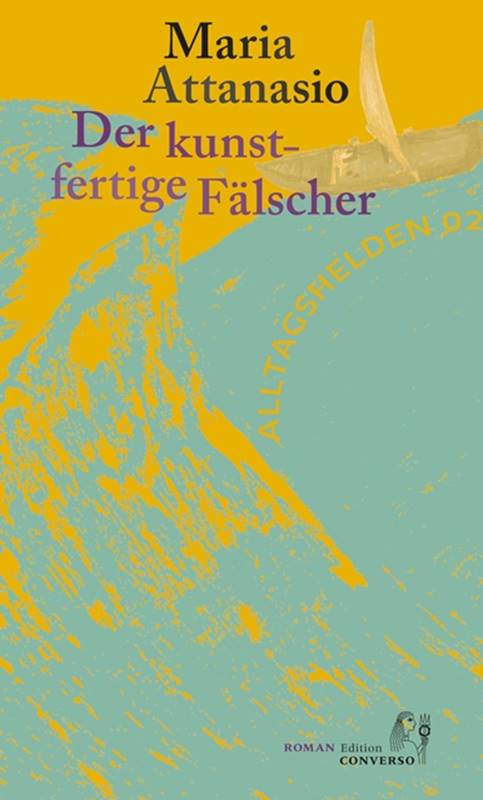
Maria Attanasio
Der kunstfertige Fälscher
Ausführliche Notizen über den kuriosen Fall des Paolo Ciulla aus Caltagirone
Aus dem sizilianischen Italienisch von Michaela Wunderle und Judith Krieg
224 S., 18 € [D], 18,60 € [A]
ISBN 978-3-9819763-7-3
ET 1. September 2020
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Ich lebte so fremd / wie in einem übersetzten Gedicht: Wählt sich ein syrisch-kurdischer Dichter das als Motto seiner Sammlung von Gedichten, die zum größten Teil, nach langer Schaffenskrise noch in der Heimat, in Deutschland dann entstanden sind, fällt dem gebannten Leser unmittelbar die Rolle des Navigierenden zwischen den zwei Polen zu: Das Über-setzen in Ich spreche von Blau, nicht vom Meer ist ein dialogträchtiger Akt der Ichwerdung unter rauen Bedingungen. Und doch bricht bei Hussein Bin Hamza auch aus den feinsten Ritzen seines Dichterboots immer wieder Humor sich Bahn, besonders in dem Teil, der dem Deutschen (Nachbarn, Sprache, Mitmenschen) gewidmet ist. Stolz wirft er, der sich gerne auf dem Teppich der deutschen Sprache ergeht, auch die ganz heutigen, schmerzlichen Themen – Flucht, Ablehnung, Fremdenhass – in das Rüttelsieb seiner Sprache, durch das er die Existenz bis auf die Knochen freilegt. Am Ende muss er „etwas in Händen halten“, ganz ohne orientalische Blumigkeit findet jene letzte Substanz Eingang in seine Gedichte. Meisterlich geht er die ewigen Themen – Gott, Dichtung und Eros an:
NUR ZWEI HÄNDE
Nur zwei Hände warst du / bis Gott einen Körper schuf, der zu ihnen passte / Er dachte /
dass du sicher etwas brauchen würdest / um dich selbst zu umarmen.
Hussein Bin Hamza ist in al-Hasaka im Nordosten Syriens geboren und später nach Beirut gegangen, wo er für renommierte Zeitungen geschrieben hat. Er hat zwei Gedichtbände auf Arabisch veröffentlicht und ist Herausgeber zahlreicher Werke zur Politik und Soziologie. Seit 2017 lebt Hussein Bin Hamza mit seiner Familie in der Nähe von Hannover. „Ich spreche von Blau, nicht vom Meer“ wurde mit dem Chamisso-Publikationsstipendium 2019 der Bayrischen Akademie der Schönen Künste ausgezeichnet.
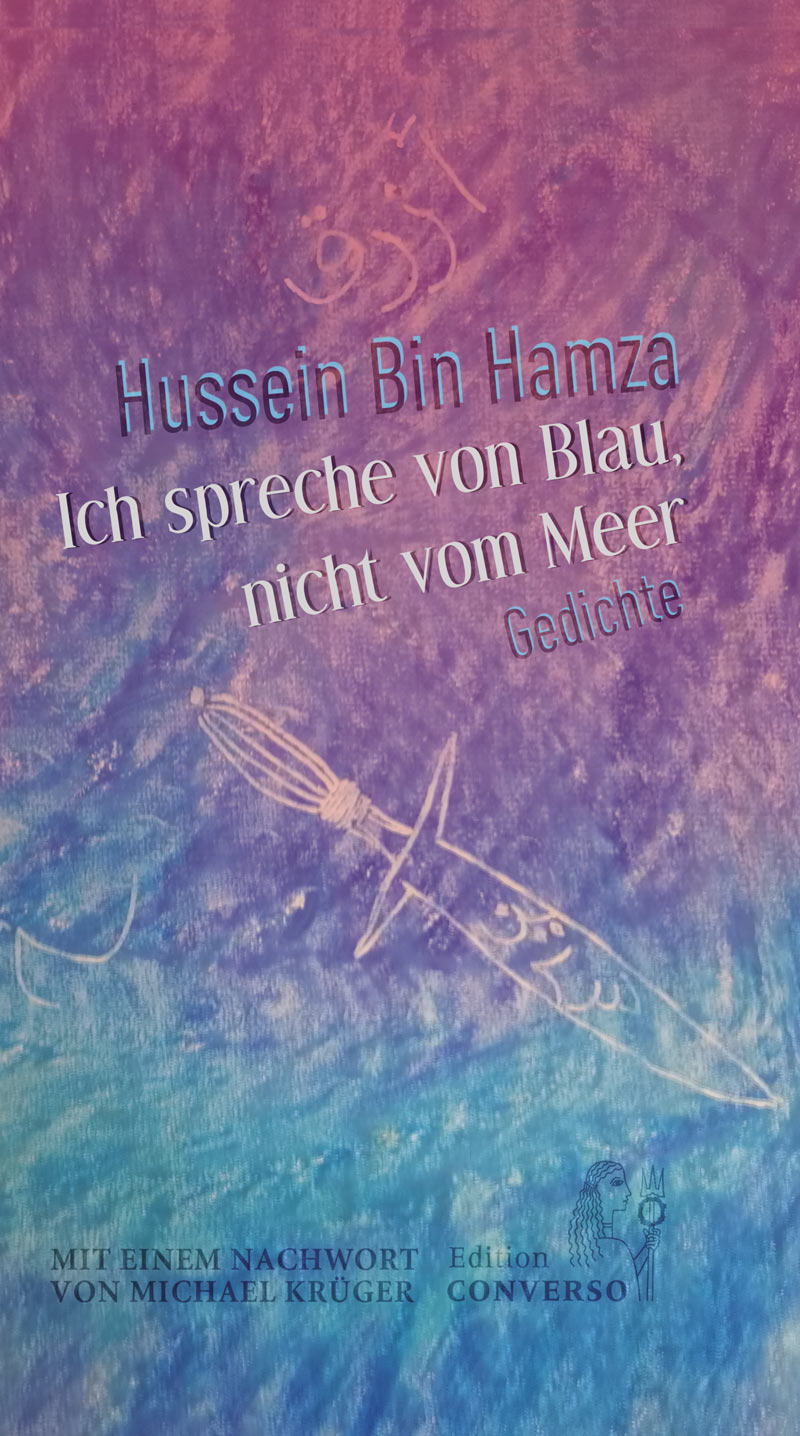
Hussein Bin Hamza
Ich spreche von Blau, nicht vom Meer
Gedichte
arabisch/deutsch
Übersetzt von Günther Orth
Hrsg. von Monika Lustig
Mit einem Nachwort von Michael Krüger
96 S. / 17 € [D], 17,50 € [A]
ISBN 978-3-9819763-6-6
ET 25. Februar 2020
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Jodel arbeitet als Toningenieur bei der Polizei, wo er Aufnahmen analysiert, um zur Aufklärung von Verbrechen beizutragen. Als er die elfjährige Jeanne kennenlernt, begreift er schnell, dass sie an derselben Gabe „leidet“ wie er: an Hyperakusis, einem extremen Hörvermögen. Die beiden freunden sich an: Jodel will Jeanne das zielgerichtete Hören beibringen, damit sie nicht im Lärm der Welt ertrinkt. Außerdem macht er die Bekanntschaft von Ulan, einem Russen, der in einem verlassenen Industriegelände mit anderen Ausgebooteten aus aller Herren Länder haust. Und er trifft Jeannes Mutter, Jaumette, eine Komponistin, und verliebt sich in sie.
Belinda Cannones Roman Vom Rauschen und Rumoren der Welt zieht die Leser in den Sog von Jodels Nachdenken über die Liebe, die Welt und die Sonderlinge in ihr: Wie gelingt es uns, inmitten von Chaos und Gewalt nicht die Ohren zu verschließen, sondern unseren moralischen Kompass zu bewahren? Wie bleiben wir empfänglich für den Lärm des Lebens, und wie können wir daraus Musik gewinnen? Und wo ist ein Platz für Menschen, die nicht der Norm entsprechen? Die französische Autorin entfaltet ein Netz aus Begegnungen, und ein erotisches Szenario, dessen Fäden sie in die Hände der Komponistin Jaumette legt, der „Ordnerin des Klangchaos“. Ein hochaktueller, sinnlicher Ideenroman, der dem Schrecklichen und dem Schönen gleichermaßen nachlauscht und beim Zuhören Widerstandskräfte entwickelt.
Belinda Cannone, von sizilianisch-korsischen Eltern in Tunesien geboren, als französische Autorin zum ›Chevalier de la Légion d’Honneur‹ ernannt, hat zahlreiche Romane, darunter „L’Homme qui jeûne“, „Nu intérieur“ verfasst. Als Essayistin ist sie eine gewichtige Stimme in der internationalen Feminismusdebatte; ihre Essays „L’Ecriture du désir“; „La Sentiment d’imposture“ wurden mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet. Sie lehrt als Assistenzprofessorin für vergleichende Literatur-wissenschaften an der Universität Caen Basse-Normandie.
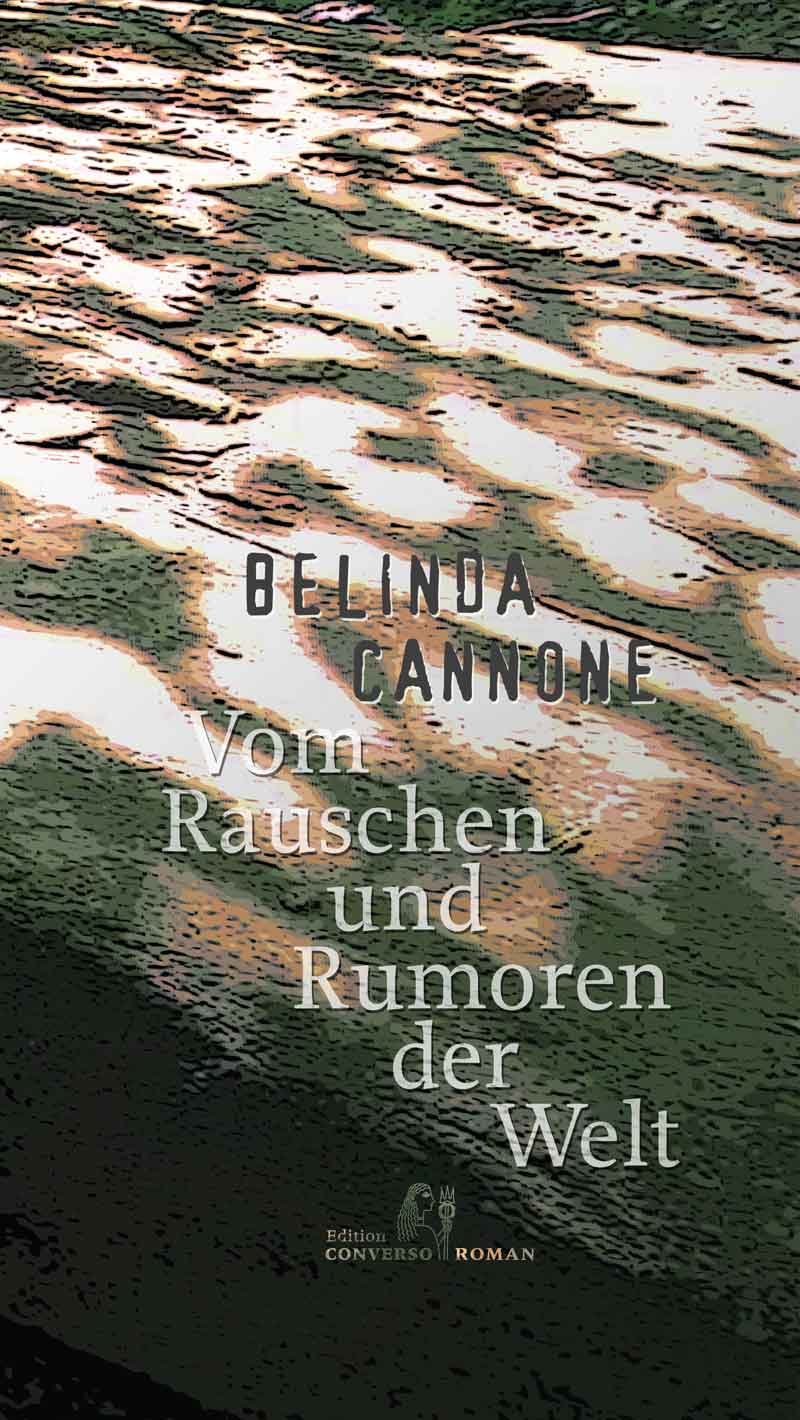
Belinda Cannone
Vom Rauschen und Rumoren der Welt
Roman aus dem Französischen von Claudia Steinitz und Tobias Scheffel
256 S., 22 € [D], 22,70 € [A]
ISBN 978-3-9819763-4-2
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
„Einen Migranten kann man erst verstehen, wenn man seine Geschichte gehört hat“: In seinem biografischen Essay erzählt der albanische, auf Griechisch schreibende Autor Gazmend Kapllani von den Jahren im „Irrenhaus“ des stalinistischen Regimes, von seiner Flucht nach Griechenland und vom schwierigen Ankommen am Sehnsuchtsort, der „Welt jenseits der Grenze“. Gemeinsam mit seinen Leidensgenossen landet er in einem griechischen Flüchtlingscamp: ein weiteres System von Unmenschlichkeit und Absurditäten, dem er dank eines Filmregisseurs entkommen kann. Doch die Bilder vom Goldenen Westen prallen auf eine Realität, die trotz vermeintlich gelungener Integration eine fremde bleibt.
Die von schwarzem Humor grundierten Schilderungen des Alltags in Albanien und im griechischen Flüchtlingscamp wechseln sich ab mit tiefgründig-selbstironischen Reflexionen über das Migrantensein und die Bedeutung von Grenzen, den sichtbaren wie den unsichtbaren. Wie umgehen mit der Zerrissenheit, mit der trügerischen Erinnerung und mit der Furcht der Einheimischen gerade vor denen, die wirklich angekommen, eben nicht mehr „anders“ sind? Ein Lehrstück über das Migrantenschicksal durch die Generationen hinweg, das heute mehr denn je seine dramatische Gültigkeit behauptet.
Gazmend Kapllani, 1967 in Lushnja, Albanien geboren, erlitt mit seiner Familie unter Enver Hodschas Regime massive Repressionen. 1991 flüchtete er nach Griechenland, wo er 24 Jahre unter anderem als Universitätsdozent und Journalist großer Tageszeitungen wirkte. Im Interview am Ende des Handbuchs streift Kapllani die schmerzhafte Erfahrung von Schikanen durch die neofaschistischen Rechten in Griechenland, die letztendlich zur Ablehnung seines Einbürgerungsgesuchs durch eine linke Regierung geführt hat. Heute lebt Gazmend Kapllani als Universitätsdozent in den USA und fühlt sich mehr denn je als leidenschaftlicher Europäer.
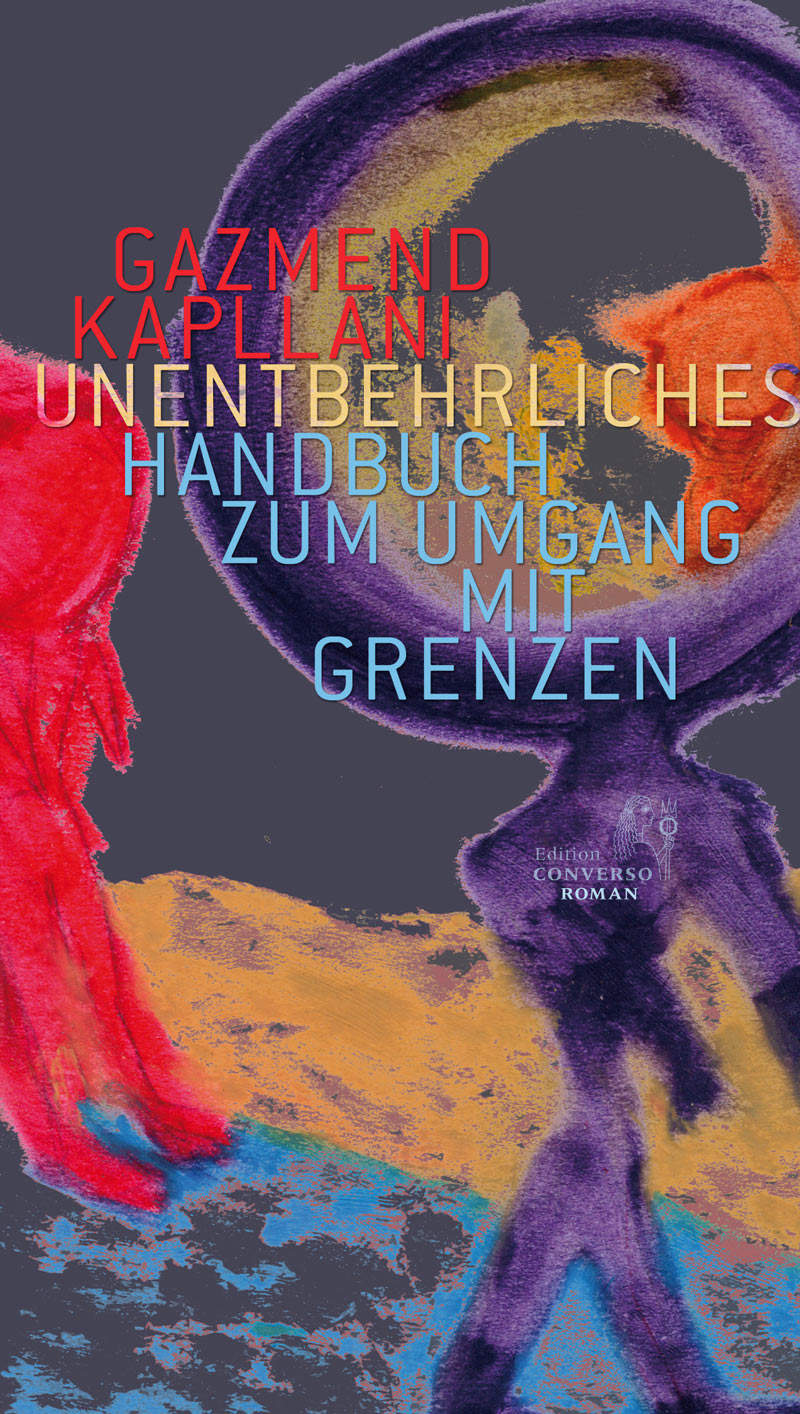
Gazmend Kapllani
Unentbehrliches Handbuch zum Umgang mit Grenzen
Biografischer Essay
Aus dem Griechischen von Nina Bungarten
Mit einem aktuellen Interview des Autors
176 S. / 19 € [D], 22,70 € [A]
ISBN 978-3-9819763-5-9
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]
Vom Grenzsyndrom, Fremd-Sein und von der Liebe zu Europa: der albanische Autor Gazmend Kapllani
 Der albanische, auf Griechisch schreibende Autor Gazmend Kapllani erzählt in seinen Büchern die Geschichte Europas von den Peripherien aus, „denn von diesem Blickwinkel aus, davon bin ich fest überzeugt, ist sie viel besser zu beobachten“. Sein Unentbehrliches Handbuch zum Umgang mit Grenzen (ET 25. Februar) wird dabei zur Chiffre für das Schicksal des Migranten, der Fremder bleibt, so gut er auch integriert sein mag, und für eine „Heimat“, die sich nicht verorten lässt.
Der albanische, auf Griechisch schreibende Autor Gazmend Kapllani erzählt in seinen Büchern die Geschichte Europas von den Peripherien aus, „denn von diesem Blickwinkel aus, davon bin ich fest überzeugt, ist sie viel besser zu beobachten“. Sein Unentbehrliches Handbuch zum Umgang mit Grenzen (ET 25. Februar) wird dabei zur Chiffre für das Schicksal des Migranten, der Fremder bleibt, so gut er auch integriert sein mag, und für eine „Heimat“, die sich nicht verorten lässt.
Hier ein Auszug aus dem Interview am Ende des Bandes: Kapllani berichtet darin auch über die Ablehnung seines Einbürgerungsantrags in Griechenland.
Wir lesen heutzutage in der deutschen Presse so manches über das stalinistische Regime unter Enver Hodscha: Es heißt, diese historische Periode sei nicht gründlich genug oder überhaupt nicht aufgearbeitet.
Gazmend Kapllani: „Dieses blutrünstige Regime hielt das Land für ein halbes Jahrhundert vom Rest der Welt isoliert und verwandelte es in einen tristen und paranoiden Menschenzoo, in dem jedoch selbst die Zoobesucher verboten waren. Das politische und kulturelle Desaster, das daraus resultierte, ist nur schwer zu beschreiben; seine Auswirkungen jedoch werden noch weitere Generationen beschäftigen. Diktaturen dieser Art sind wie Atombomben. Albanien lässt sich nur begreifen, wenn man es auch als festen Bestandteil der mühsamen, qualvollen, aufgewühlten Geschichte Europas insgesamt beurteilt, d. h. wenn man es als Teil Osteuropas während des Kalten Kriegs betrachtet. (…)
Zum Thema Aufarbeitung in concretis: Auf der einen Seite haben wir es mit einem kleptokratischen und mafiösen Kapitalismus zu tun, auf der anderen mit einer finsteren Vergangenheit, die Tag für Tag unser Gewissen vergiftet hat. Wir stehen vor der Notwendigkeit, uns der quälenden Gewissensfrage zu stellen, nämlich zu klären: Wie ist es möglich, dass ein Großteil der albanischen Gesellschaft zum Erfüllungsgehilfen, zum Komplizen eines so unmenschlichen Regimes wurde? Genau darum geht es ja. Doch um dieser großen Verpflichtung nachkommen zu können, bedürfen wir einer kleinen Unterstützung seitens unserer europäischen Freunde. Nach so vielen Jahren der Selbstisolation müssen wir uns als Teil des europäischen Kontinents fühlen, als Teil der Europäischen Union. Für uns ist das eine existenzielle Frage.“
Als die griechischen Autoritäten dir nach 24 Jahren im Land die griechische Staatsangehörigkeit verweigert haben, welche waren deine Reaktionen? Sicherlich war es eine bodenlose Enttäuschung?
Kapllani: „Das ist eine sehr schmerzhafte Geschichte. Es handelt sich in der Tat um einen echten juristischen und politischen Skandal; zugleich ist die Geschichte sehr komplex. Denn in Griechenland bin ich zu einem überaus bekannten Schriftsteller und Journalisten geworden. Doch genau aus diesem Grund geriet ich auch ins Visier obskurer Apparate des griechischen Staats und der Faschisten. Griechenland ist ein besonders ungastliches Land gegenüber jedwedem, der einer Minderheit angehört – mit Ausnahme der Minderheit der Touristen. (…) Auf der Gegenseite steht die griechische Linke, die zwar gastfreundlicher und gegenüber den Einwanderern offener ist, jedoch oft von einer stark populistischen und extrem autoritären Mentalität beherrscht ist. Diese Linke kann gegenüber einem kritischen und unabhängigen Denken äußerst misstrauisch sein, besonders wenn dahinter Personen stehen, die sich am Rande des Systems befinden. Es war in der Tat die regierende Linke, die auf die zynischste Weise, die man sich nur vorstellen kann, meinen berechtigten Antrag auf griechische Staatsbürgerschaft abgewiesen hat. Indem sie das tat, ist sie paradoxerweise einem der großen Anliegen der extremen Rechten und der griechischen Neonazis nachgekommen. (…) Griechenland nach so vielen Jahren zu verlassen (…) habe ich als regelrechte Verstümmelung auf kultureller und persönlicher Ebene erlebt, als hätte man mich eines oder mehrerer Gliedmaßen beraubt. Die Spuren, die dieser Akt der Gewalt in mir hinterlassen hat, sind tief, und ich hoffe, sie literarisch eines Tages verarbeiten zu können: Mir daraus eine Lebensphilosophie schmieden.
Meines Dafürhaltens bin ich jetzt, da ich in den USA lebe, mehr Europäer geworden. Hier habe ich die Möglichkeit, die moderne europäische Geschichte zu unterrichten. Meine Herkunft aus dem Balkan gestattet mir einen anderen und noch vielschichtigeren Blick auf Europa. Ich vermittle meinen Studenten viel Wissen über die Balkanstaaten und Osteuropa, damit sie lernen: Europa ist nicht gleichbedeutend mit jenen sechs oder sieben reichsten nordeuropäischen Ländern. (…)“
Gazmend Kapllani, 1967 in Lushnja, Albanien geboren, erlitt mit seiner Familie unter Enver Hodschas Regime massive Repressionen. 1991 flüchtete er nach Griechenland, wo er 24 Jahre unter anderem als Universitätsdozent und Journalist großer Tageszeitungen wirkte. Heute lebt Gazmend Kapllani als Universitätsdozent in den USA. In seinem biografischen Essay Unentbehrliches Handbuch zum Umgang mit Grenzen berichtet er von den Jahren unter der Diktatur, von seiner Flucht und vom schwierigen Ankommen am Sehnsuchtsort.
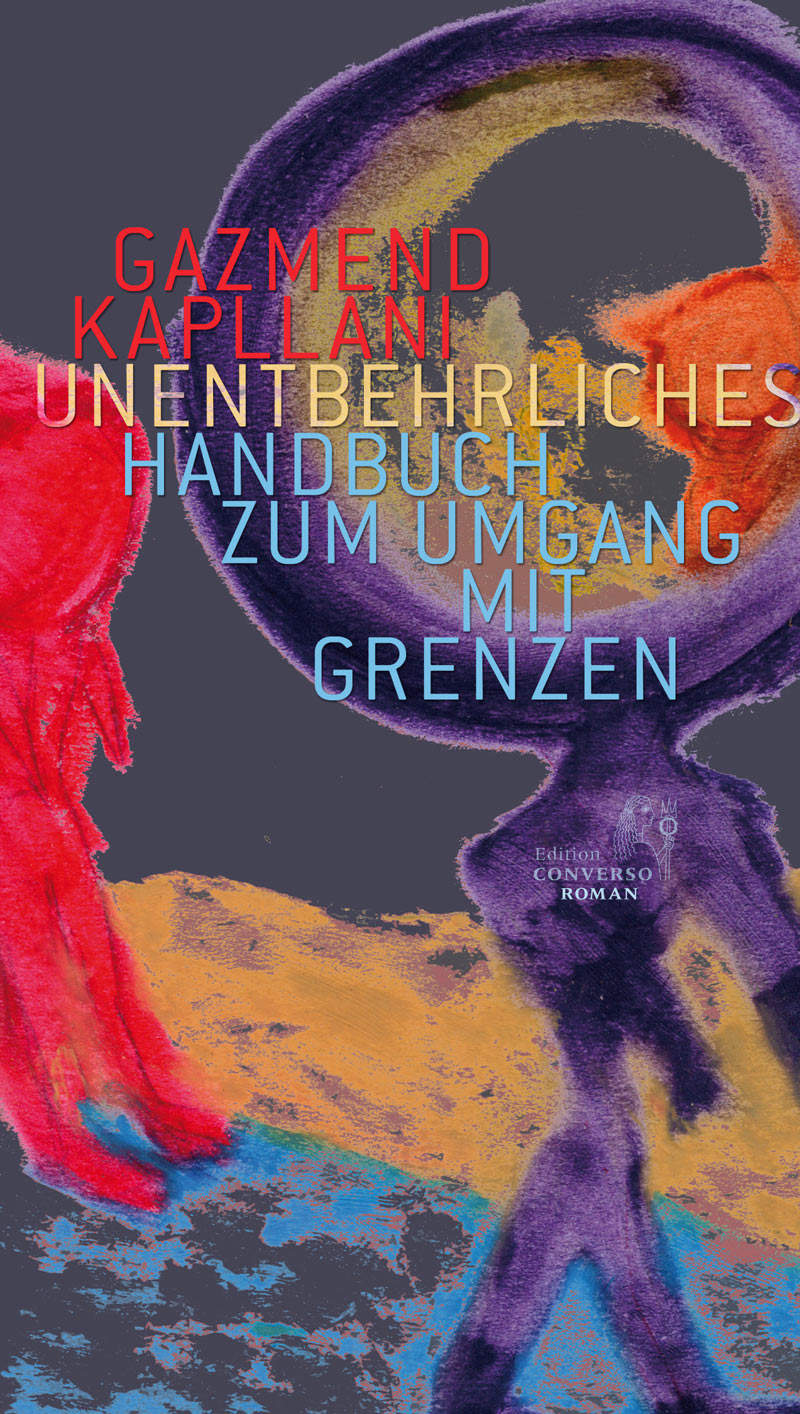
Gazmend Kapllani
Unentbehrliches Handbuch zum Umgang mit Grenzen
Biografischer Essay
Aus dem Griechischen von Nina Bungarten
Mit einem aktuellen Interview des Autors
176 S. / 19 € [D], 22,70 € [A]
ISBN 978-3-9819763-5-9
Pressekontakt und Rezensionsexemplare:
E-Mail: presse@edition-converso.com;
Tel: 0721 4908 35 35
[Pressemeldung als PDF herunterladen] [druckgerechtes Buchcover herunterladen]